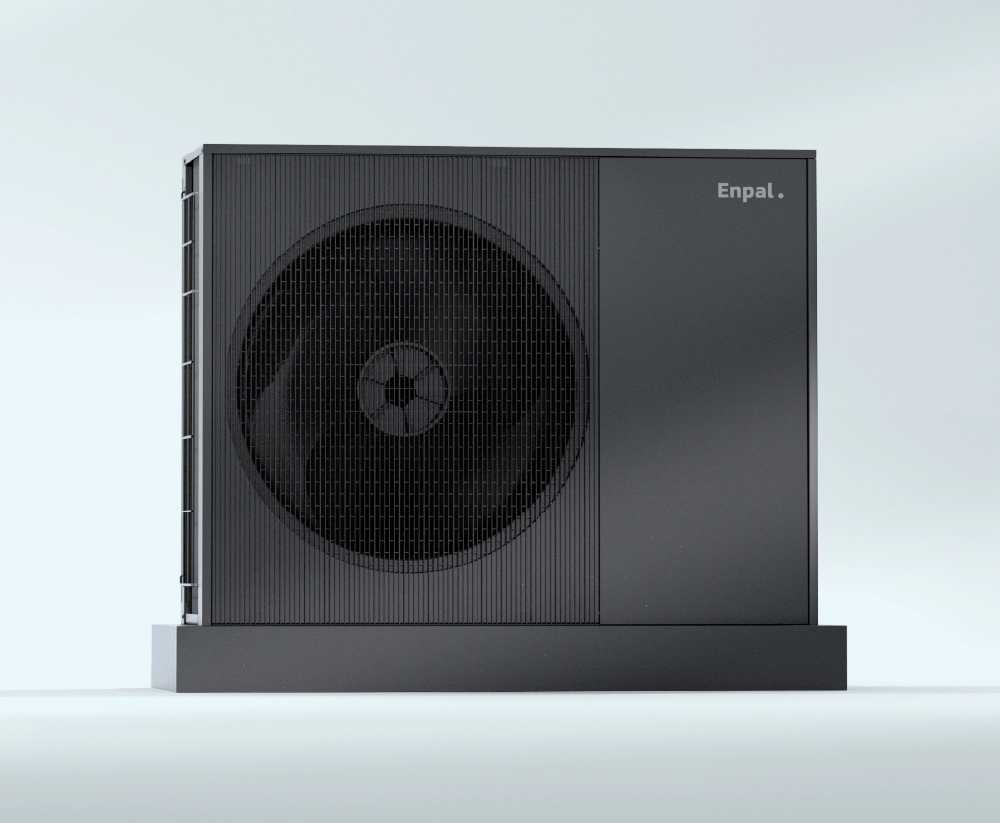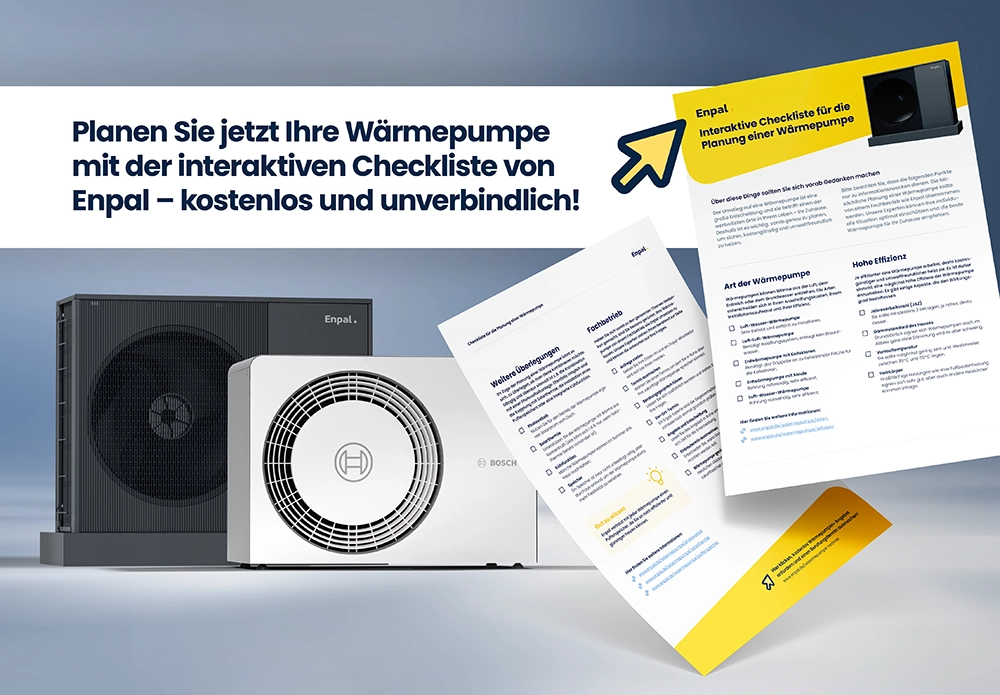Wärmepumpe bei Enpal
Wirklich günstig heizen: Jetzt Förderung nutzen und Wärmepumpe ab 7.800 € flexibel finanzieren oder kaufen1
Das Enpal Versprechen
Komfortabler Heizungstausch zum Festpreis

10 Jahre Garantie, Wärmeversprechen selbst an den kältesten Tagen und nur 30 Tage von Unterschrift bis Installation. So geht der Heizungstausch sicher, komfortabel und schnell. Mehr Informationen dazu hier.
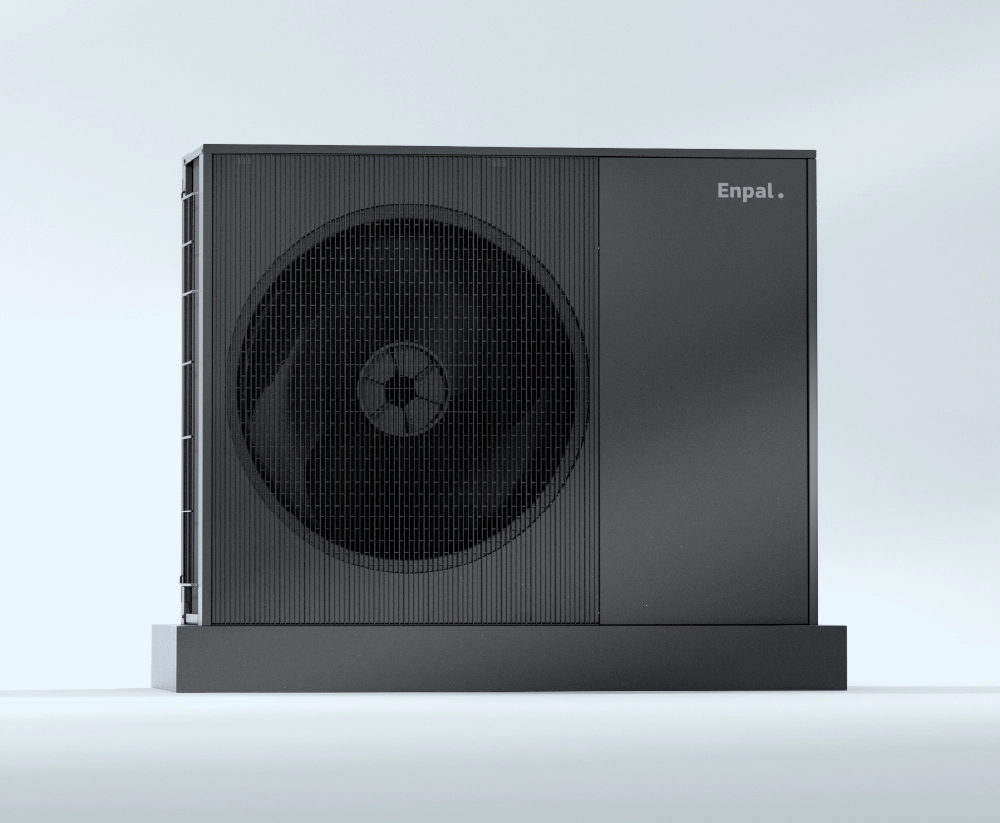
Die Enpal Wärmepumpe
Perfekt für Bestandsbauten
Die Wärmepumpe heizt vier Mal effizienter als eine Gasheizung - auch, wenn es draußen extrem kalt ist. Dank der Vorlauftemperatur von bis zu 80 Grad ist sie auch perfekt für Bestandsbauten. Mehr Informationen dazu hier im Datenblatt.
Bis zu 45 % günstiger heizen
Komplett unabhängig von Öl & Gas

Mit einer Wärmepumpe lassen sich die Heizkosten um bis zu 45 % reduzieren. Das Beste: Dank der staatlichen Förderung ist der Umstieg so günstig wie nie zuvor. Mehr Informationen dazu hier.

Für die kommenden Generationen
Zukunftssicher heizen
Dank der cleveren Nutzung von Umgebungswärme stößt die Wärmepumpe deutlich weniger CO2 aus als fossile Heizungen. Wenn sie mit einer Solaranlage kombiniert wird, dann sogar fast nichts. Mehr Informationen dazu hier: Wärmepumpe Nachhaltigkeit
So funktioniert’sJetzt Wärmepumpe anfragen

Unverbindliches Angebot anfragen
Nach der Eingabe der wichtigsten Eckdaten erfahren Sie im ersten Schritt, ob die Wärmepumpe von Enpal für Ihr Haus verfügbar ist.
Kostenlos beraten lassen
Unsere Wärmepumpen-Experten erstellen ein individuelles Angebot und beraten Sie kostenfrei, um unsere Lösung perfekt auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.
Enpal-Profis installieren Ihre Wärmepumpe
Bis zur Installation Ihrer neuen Wärmepumpe durch unsere Handwerkerteams in Ihrer Region vergehen im Schnitt nur vier Wochen.
Alles richtig gemacht!Was Enpal Kunden sagen
Wirklich günstig heizenMichael Kessler zeigt, wie es geht

00:00
/
00:00
Die Energielösung von EnpalFür jeden die perfekte Lösung

Nur bei Enpal: Die Energielösung mit dem höchsten Sparpotenzial.
- Mit der PV-Anlage einfach Haushalt, Wärmepumpe und E-Auto versorgen.
- Dank Stromspeicher und Enpal.One+ maximale Unabhängigkeit.
- Mit dem intelligenten Betriebssystem Enpal.One+ Geld verdienen und sparen.
Das alles für 0 € Anzahlung, flexibler Finanzierung und Rundum-Sorglos-Service – montiert in nur wenigen Wochen!
Alles, was Sie zur Wärmepumpe wissen müssen
Wärmepumpen sind eine nachhaltige, emissionsarme und langfristig kostengünstige Alternative zu fossilen Öl- oder Gasheizungen. Im Folgenden haben wir alle Informationen zu Wärmepumpen gesammelt und für Sie aufbereitet - von der Funktion über die Kosten bis hin zur Installation.
Wärmepumpe Funktion & Arten: Das Wichtigste in Kürze
- Eine Wärmepumpe heizt ohne fossile Brennstoffe wie Gas, Öl oder Kohle.
- Stattdessen nutzt die Wärmepumpe Wärme aus der Umgebung, um ein Gebäude zu beheizen.
- Je nach Wärmequelle unterscheidet man Luft-, Erd- und Wasserwärmepumpen.
- Wärmepumpen haben mit Abstand den höchsten Wirkungsgrad aller Heizsysteme.
Mit der Heizung Geldbeutel und Umwelt schonen? Das geht! Mit einer Wärmepumpe. Sie wandelt Wärme aus der Umgebung unter Nutzung von Strom in Heizwärme für Haus und Warmwasser um – ganz ohne fossile Brennstoffe.
Das Besondere: Eine Wärmepumpe arbeitet hocheffizient und macht aus 1 kWh Strom im Normalfall 3 bis 5 kWh Wärmeenergie – sogar im Winter. Damit ist sie 3-5 Mal so effizient wie eine Gas- oder Ölheizung.
Wie das funktioniert, warum sie so effizient ist und welche Arten von Wärmepumpen es gibt, erklären wir in den nächsten Abschnitten.
Wie funktioniert eine Wärmepumpe?
Eine Wärmepumpe funktioniert im Wesentlichen wie ein umgekehrter Kühlschrank. Sie entzieht der Umgebung Wärme und gibt diese als Heizenergie an das Gebäude ab.
Der Wärmepumpen-Kreislauf hat 4 Schritte:
- Die Umgebungswärme wird aufgenommen und auf das Kältemittel der Wärmepumpe übertragen. Dieses verdampft im Verdampfer.
- Die Temperatur des Kältemittels wird durch Druck im Kompressor (auch Verdichter) weiter erhöht.
- Der heiße Kältemitteldampf gelangt anschließend in den Wärmetauscher (Kondensator). Dort gibt er seine Wärme an das Heizsystem des Haushalts ab.
- Im Verflüssiger sinkt die Temperatur wieder und im Expansionsventil wird der Druck verringert. Danach beginnt der Kreislauf von vorne.
Für mehr Details empfehlen wir diesen Artikel: Wie funktioniert eine Wärmepumpe?
Welche Wärmepumpen-Arten gibt es?
In erster Linie unterscheidet man die verschiedenen Wärmepumpen-Arten nach ihrer Wärmequelle. So gibt es:
- Luftwärmepumpen: Diese lassen sich noch weiter in Luft-Luft-Wärmepumpen und die überaus beliebten Luft-Wasser-Wärmepumpen unterteilen. Beide nutzen die Wärme aus der Umgebungsluft. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe gibt die Wärme direkt an das Heizsystem weiter und ist deswegen die beliebteste Art der Wärmepumpe.
- Erdwärmepumpen: Sie werden auch Sole-Wasser-Wärmepumpen genannt und nutzen entweder Erdkollektoren oder Erdsonden, um die Wärme aus dem Erdreich zu gewinnen. Für beide sind Bohrungen im Erdreich nötig.
- Wasserwärmepumpen: Hierbei handelt es sich zumeist um Grundwasserwärmepumpen, die die konstante Temperatur des Grundwassers nutzen. Neben den Bohrungen, um das Grundwasser zu erreichen, muss hier auch ein Brunnensystem installiert werden.

Die Tabelle gibt einen ersten Überblick über die Hauptmerkmale. Eine detaillierte Beschreibung der Unterschiede gibt es in diesem Artikel: Wärmepumpen im Vergleich
Neben der klassischen Einteilung nach Wärmequellen gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Merkmale, nach denen sich Wärmepumpen unterscheiden lassen:
Gut zu wissen: Die Merkmale können sich überschneiden. So kann eine Propan-Wärmepumpe gleichzeitig modulierend und bivalent arbeiten und eine Monoblock-Wärmepumpe sein. Genau das ist auch der Fall bei der von Enpal verbauten Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Wie effizient ist eine Wärmepumpe?
Wärmepumpen haben je nach Art und Modell eine Effizienz zwischen 300 und 500 %. Das heißt, die Pumpe kann aus einer Kilowattstunde Strom 3 bis 5 Kilowattstunden Wärmeenergie bereitstellen. Kein anderes Heizsystem hat einen höheren Wirkungsgrad.
Zum Vergleich: Der Wirkungsgrad einer Gasheizung liegt bei etwa 90 %, der Wirkungsgrad einer Ölheizung liegt bei alten Modellen sogar bei nur etwa 70 %.
Wie wird die Effizienz einer Wärmepumpe gemessen?
Die Effizienz der Wärmepumpe wird anhand mehrerer Kennzahlen gemessen, allen voran die Jahresarbeitszahl (JAZ) und der COP-Wert. Während der COP (Coefficient of Performance) die Effizienz unter spezifischen Testbedingungen angibt, berücksichtigt die JAZ die Effizienz über den Jahresverlauf hinweg.
Häufig gestellte Fragen zu Funktion & Arten von Wärmepumpen
Funktioniert eine Wärmepumpe auch im Winter?
Ja, eine Wärmepumpe funktioniert auch im Winter – völlig unabhängig davon, ob die Wärme aus der Luft, der Erde oder dem Grundwasser verwendet wird. Selbst bei -20 °C kann eine Wärmepumpe im Winter der Umgebung noch genug Wärme entziehen, um ein Haus problemlos zu beheizen.
Wie lange hält eine Wärmepumpe?
Eine Wärmepumpe hält in der Regel problemlos 15 bis 25 Jahre. Die genaue Lebensdauer ist abhängig von der Installation, Wartung und Modellqualität. Mit regelmäßigen Wartungen kann die Lebensdauer der Wärmepumpe maximiert werden. Auch ein gleichmäßiger Betrieb trägt dazu bei, dass die Wärmepumpe lange hält.
Wie laut ist eine Wärmepumpe?
Eine moderne Wärmepumpe hat eine durchschnittliche Lautstärke von 30 bis 60 Dezibel (dB). Das ist in etwa so „laut“ wie ein Flüstern oder ein Kühlschrank. Die Lautstärke der Wärmepumpe ist für Menschen also kein Störfaktor. Damit ist auch klar, dass man im Normalfall keine spezielle Schallschutzhaube für Wärmepumpen braucht.
Gut zu wissen: Nachts dürfen Wärmepumpen nicht lauter sein als 35 dB, da sie ansonsten die Nachtruhe stören könnten.
Nutzen Sie auch unser interaktives Soundtool, um die Lautstärke einer Wärmepumpe im Vergleich zu hören.
Mit diesem Tool bekommen Sie einen Eindruck davon, wie laut bzw. leise eine Wärmepumpe im Vergleich zu anderen Umgebungsgeräuschen ist.
Wärmepumpen Geräuschvergleich
Klicken Sie auf eine Geräuschquelle, um deren Dezibelwert mit einer Wärmepumpe zu vergleichen.
Stellen Sie Ihre Lautsprecher am besten so ein, dass Ihnen das Einzelgespräch in normaler Lautstärke vorkommt.



Wie lange läuft eine Wärmepumpe am Tag?
Wie lange eine Wärmepumpe am Tag läuft, hängt von der Außentemperatur ab. Je kälter es ist, desto länger läuft sie.
In der Heizperiode läuft eine Wärmepumpe im Normalfall ca. 8 bis 12 Stunden pro Tag. In den richtig kalten Wintermonaten läuft sie länger als in den Übergangszeiten im Frühling und Herbst.
Im Sommer reichen hingegen meist schon 1 bis 3 Betriebsstunden pro Tag, um das Warmwasser bereitzustellen.
Welche Wärmepumpe ist am effizientesten?
Am effizientesten ist die Grundwasserwärmepumpe, dicht gefolgt von der Erdwärmepumpe. Doch die Effizienz hat ihren Preis: Erd- und Wasserwärmepumpen sind vergleichsweise teuer, da für sie hohe Erschließungskosten anfallen.
Luftwärmepumpen sind zwar minimal weniger effizient, da die Umgebungsluft größeren Schwankungen unterliegt. Dafür haben sie keinerlei Erschließungskosten und sind viel einfacher zu installieren.
Deswegen ist die Luftwärmepumpe mit Abstand die beliebteste Wärmepumpenart in Deutschland.
Kann man mit einer Wärmepumpe auch kühlen?
Ja, je nach Art und Modell kann man mit einer Wärmepumpe auch kühlen. Dadurch kann man eine Wärmepumpe als eine Art Klimaanlage verwenden. Allerdings sind dafür spezielle Zusatzkomponenten erforderlich. Mehr dazu in diesem Artikel: Wärmepumpe kühlen
Gut zu wissen: Enpal bietet aktuell keine Kühlfunktion an.
Welche Wärmepumpen-Hersteller gibt es?
Der größte Anbieter im Wärmepumpen-Markt ist Enpal. Weitere wichtige deutsche Wärmepumpen-Hersteller und Anbieter sind Bosch, Viessmann, Vaillant und Stiebel Eltron.
Eine genauere Übersicht über Hersteller und Anbieter haben wir hier zusammengestellt: Wärmepumpen-Hersteller und Anbieter
Wärmepumpe Kosten & Förderung: Das Wichtigste in Kürze
- Eine Wärmepumpe kostet zwischen 29.000 und .000 €.
- Mit staatlichen Förderungen lässt sich dieser Preis um bis zu 70 % reduzieren.
- Monatlich fallen für die Wärmepumpe nur Stromkosten an, die in der Regel weit unter den monatlichen Kosten für eine Gas- oder Ölheizung liegen.
- Die Wartungskosten belaufen sich jährlich auf etwa 150 - 450 €.
- Bei Enpal bekommen Sie die beliebte Luft-Wasser-Wärmepumpe je nach Fördersatz schon ab 7.800 €.
Die Preisspanne bei Wärmepumpen ist groß und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Gleichzeitig gibt es attraktive Förderungen, mit denen die Anschaffungskosten stark gesenkt werden können. Wir erläutern, was aktuell relevant ist.
Was kostet eine Wärmepumpe?
Eine Wärmepumpe inklusive Montage kostet je nach Art und Leistung meist ca. 29.000 - 47.000 €. In Ausnahmefällen kann der Preis noch deutlich höher sein, vor allem für Erd- und Wasserwärmepumpen. Generell lassen sich die Kosten einer Wärmepumpe in Anschaffungskosten, Erschließungskosten, Installationskosten und Betriebskosten unterteilen.
Gerät
Das Grundgerät der Wärmepumpe kostet in der Anschaffung im Schnitt um die 29.000 €. Allerdings sind die Preisspannen groß und die tatsächlichen Kosten können je nach Art, Modell und Hersteller mitunter stark abweichen.
Erschließung
Erschließungskosten liegen in der Regel bei etwa 10.000 €. Diese fallen allerdings nur bei Erd- und Wasserwärmepumpen an. Sie nutzen die Wärme des Erdreichs bzw. des Grundwassers zum Heizen. Um entsprechende Anlagen zu installieren, müssen Bohrungen zur Erschließung des Erdreichs bzw. des Grundwassers durchgeführt werden. Diese sind je nach Bohrtiefe und anderen Faktoren sehr unterschiedlich im Preis.
Installation
Die Installation der Wärmepumpe kostet je nach Aufwand bis zu 12.000 €. Dabei spielen vor allem der Wärmepumpentyp und der Aufstellort der Wärmepumpe eine wichtige Rolle. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe an einem optimalen Standort kann die Installationskosten der Wärmepumpe stark reduzieren.
Gut zu wissen: Bei Enpal sind die Installationskosten immer im Komplettpaket enthalten.
Betrieb
Die Betriebskosten einer Wärmepumpe liegen im Normalfall zwischen 500 und 1.500 € pro Jahr. Das entspricht monatlichen Kosten zwischen 42 und 125 €. Hinzu kommen Wartungskosten von ca. 150 - 450 € pro Jahr. Für ein deutsches Durchschnittshaus könnten die Betriebskosten so aussehen:
Die Betriebskosten werden hauptsächlich durch die Effizienz der Wärmepumpe, den Wärmebedarf des Haushalts und den Strompreis bestimmt.
Gibt es eine Förderung für Wärmepumpen?
Ja, die Anschaffung einer Wärmepumpe wird aktuell bis zu 70 % vom Staat bezuschusst! Diese Förderung soll bis 2029 bestehen bleiben. Wer eine Wärmepumpe kaufen möchte, kann neben der bundesweiten Förderung mitunter auch von regionalen Förderprogrammen und Finanzierungsmöglichkeiten profitieren. Die genaue Förderhöhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, die staatliche Wärmepumpen-Förderung wird über die KfW abgewickelt und setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
Nutzen Sie unseren Förderrechner, um einen ersten Eindruck davon zu bekommen, welche Förderhöhe für Sie möglich wäre:
Welche KfW-Förderungen für Wärmepumpen gibt es?
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert Wärmepumpen über verschiedene Programme, wobei das wichtigste für Hauseigentümer die Heizungsförderung für Privatpersonen (KfW 458) ist. Mehr Informationen dazu hier: KfW-Förderungen für Wärmepumpen
Förderung Wärmepumpe nach Bundesland
Neben der bundesweiten KfW-Förderung bieten auch die einzelnen Bundesländer Zuschüsse, Darlehen, Förderungen oder zumindest Förder- und/oder Energieberatungen an. Klicken Sie einfach auf Ihr Bundesland und finden Sie heraus, wie eine Wärmepumpe aktuell in Ihrer Region gefördert wird.
Württemberg
Wie viel kostet eine Wärmepumpe für ein Einfamilienhaus pro Quadratmeter?
In der Regel kostet eine Wärmepumpe monatlich pro Quadratmeter zwischen 0,50 € und 1,50 €.
Die Betriebskosten für eine Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus mit 150 m² Wohnfläche könnten wie folgt aussehen:
- JAZ der Wärmepumpe: 4 (aus einer kWh Strom macht sie 4 kWh Wärme)
- Wärmebedarf des Hauses: Mittel → 130 kWh pro m² → 19.500 kWh pro Jahr (1.625 kWh pro Monat)
- Strompreis: 21 Cent pro kWh
Die Wärmepumpe braucht 4.875 kWh Strom, um 19.500 kWh Wärme bereitzustellen. Daraus ergeben sich jährliche Stromkosten von 1.023,75 €. Auf den Monat gerechnet sind das 85,31 €. Pro Quadratmeter sind das ca. 0,57 €.
Zum Vergleich: Die Betriebskosten für eine Gasheizung liegen bei gleichem Wärmebedarf und einem Gaspreis von 11 Cent pro kWh bei 2.145 € pro Jahr (178,75 € pro Monat und 1,19 € pro m²). Damit ist die Gasheizung doppelt so teurer wie die Wärmepumpe.
Hier sind weitere Beispielrechnungen für gängige Einfamilienhausgrößen (mit den gleichen Annahmen):
Ihr Haus hat eine andere Quadratmeterzahl, einen anderen Wärmebedarf oder Sie zahlen einen anderen Strompreis? Nutzen Sie dafür unseren Rechner und erhalten Sie die Kosten für Ihre individuelle Situation. Einfach Werte eintragen:
Häufig gestellte Fragen zur Kosten & Förderung von Wärmepumpen
Wie lange läuft die aktuelle Förderung noch?
Die aktuelle Förderung für Wärmepumpen läuft bisher auch in 2026. In der Hängepartie um die GEG-Novelle lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob das so bleibt. Eine komplette Abschaffung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ist jedoch nicht zu erwarten.
Wird die Wärmepumpe noch von der BAFA gefördert?
Nein, die aktuellen Förderprogramme für die Wärmepumpe laufen seit 2024 über die KfW. In Einzelfällen kann es jedoch noch Fördermaßnahmen der BAFA geben, die auch Sanierungsmaßnahmen betreffen, in deren Rahmen Wärmepumpen verwendet werden.
Eine aktuelle Übersicht zu allen BAFA-Förderprogrammen im Eigenheim gibt es hier: BAFA-Förderungen in der Übersicht
Sollte ich eine Wärmepumpe mieten oder kaufen?
Im Wärmepumpen-Mietmodell zahlt der Hausbesitzer über die Vertragslaufzeit von mehreren Jahren hinweg einen festen monatlichen Mietpreis und kann die Wärmepumpe mit allen Vorteilen nutzen. Die Vorteile bei den meisten Anbietern sind dann 0 € Anschaffungskosten, planbare monatliche Raten und ein Rundum-Sorglos-Paket.
Beim Kauf hingegen hat man zwar hohe Anschaffungskosten, verpflichtet sich aber zum Beispiel auch nicht zu langfristigen Zahlungen. Ob man lieber mietet oder kauft, hängt also vor allem von der individuellen Situation ab.
Eine weitere Möglichkeit ist die Enpal EasyFlex-Finanzierung. Dieses Modell vereint die Vorteile von Miete und Kauf: 0 € Anzahlung, komplett flexible Ratenzahlungen inkl. kostenfreier Sondertilgungen und ein flexibel zubuchbares Service-Paket.
Wann amortisiert sich eine Wärmepumpe?
Eine Wärmepumpe amortisiert sich normalerweise nach 8 bis 15 Jahren. Die genaue Amortisationszeit einer Wärmepumpe hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und den aktuellen Energiepreisen ab. Einen Rechner und weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: Amortisation Wärmepumpe
Wärmepumpe Voraussetzungen & Planung: Das Wichtigste in Kürze
- Grundvoraussetzung für alle Wärmepumpen ist eine gute Dämmung des Hauses, passende Heizkörper und ein Starkstromanschluss.
- Es müssen 2-3 m² Platz auf dem Grundstück vorhanden sein.
- Luftwärmepumpen sind genehmigungsfrei. Erd- und Grundwasserwärmepumpen brauchen meist spezielle Genehmigungen von Behörden.
- Es lohnt sich, bei der Planung der Wärmepumpe über eine Kombination mit Photovoltaik nachzudenken.
- Es ist essenziell, die Wärmepumpe optimal zu planen und richtig zu dimensionieren.
- Unsere Enpal-Experten planen Ihre Wärmepumpe optimal nach Ihren Bedürfnissen.
Die Wärmepumpe ist eine der größten und wichtigsten Investitionen, die Hausbesitzer für das eigene Zuhause tätigen können. Um den größtmöglichen Nutzen aus dieser Investition zu ziehen, ist die richtige Planung das A und O. Wo stellt man eine Wärmepumpe am besten auf? Braucht sie ein Fundament? Und welche Abstände muss man einhalten? Antworten auf diese und andere Fragen finden Sie hier.
Was sind die allgemeinen Voraussetzungen für die Installation einer Wärmepumpe?
Je nach Art der Wärmepumpe variieren die Voraussetzungen für die Installation etwas. Für alle Wärmepumpen gelten jedoch diese drei wichtigen Punkte:
- Gute Dämmung des Hauses: Damit die Wärmepumpe effizient läuft und die Kosten niedrig bleiben, muss das Gebäude gut isoliert sein. Eine gute Dämmung an Wänden, Decken, Türen und Fenstern sorgt dafür, dass möglichst wenig Wärme verloren geht und die Wärmepumpe nicht unnötig viel Strom verbraucht.
- Passende Heizkörper: Wärmepumpen arbeiten bei einer niedrigen Vorlauftemperatur am effizientesten. Deswegen gilt: Je größer die Fläche des Heizkörpers, desto besser. Gut dafür geeignet ist z. B. eine Fußbodenheizung. Aber auch andere Heizkörper können funktionieren. Mehr dazu hier: Wärmepumpe Heizkörper
- Drehstromanschluss: Die meisten Wärmepumpen benötigen Starkstrom, auch Drehstrom genannt, mit einer Spannung von 400 Volt. Diese Form des elektrischen Stroms hat eine höhere Leistungsfähigkeit und einen besseren Wirkungsgrad als Haushaltsstrom mit 230 Volt.
Tipp:
Sie können mit einem einfachen Test herausfinden, ob sich eine Wärmepumpe grundsätzlich für Ihr Zuhause eignet. Dieser sollte an mehreren, aufeinander folgenden Tagen bei kalten Außentemperaturen durchgeführt werden.
Schritt 1: Stellen Sie die Vorlauftemperatur Ihrer aktuellen Heizung auf 50-55 °C und schalten Sie die Nachtabsenkung aus.
Schritt 2: Drehen Sie die Thermostate an den Heizkörpern auf Stufe 3, das entspricht etwa 20 °C.
Schritt 3: Beobachten Sie, ob die Räume ausreichend warm werden.
Ist das der Fall, ist Ihr Zuhause wahrscheinlich für eine Wärmepumpe geeignet. Ist das nicht der Fall, heißt das nicht zwingend, dass für das Gebäude keine Wärmepumpe infrage kommt. Gegebenenfalls müssen dann aber die Heizkörper ausgetauscht oder Sanierungen vorgenommen werden. Mehr dazu auch im Abschnitt Wärmepumpe im Altbau
Was sind die spezifischen Voraussetzungen für verschiedene Wärmepumpen?
Luft-Wasser-Wärmepumpen benötigen ausreichend Platz und eine optimale Luftzirkulation an ihrem Aufstellort. Auch die Traglast und der Abstand zu den Nachbarn ist relevant. Im Normalfall lässt sich die Luft-Wasser-Wärmepumpe aber einfach an einem geeigneten Standort rund um das Haus aufstellen.
Erdwärmepumpen mit Erdwärmesonden benötigen die richtige Bodenbeschaffenheit mit guter Wärmeleitfähigkeit. Für den Einsatz von Erdkollektoren ist genügend Grundstücksfläche Voraussetzung, die nach Einbau der Kollektoren weder versiegelt noch mit Tiefwurzlern begrünt werden darf.
Grundwasserwärmepumpen brauchen einen ausreichend hohen Grundwasserspiegel und möglichst wenig Eisen und Mangan im Wasser, außerdem ist die Fließrichtung relevant. Auch hier muss das Grundstück groß genug sein, um die Brunnenanlage zu bauen.
Welche Genehmigungen sind Voraussetzung für eine Wärmepumpe?
Für Luft-Wasser- und Sole-Wasser-Wärmepumpen mit Erdkollektoren sind in der Regel keine Genehmigungen erforderlich.
Erdwärmepumpen mit Sonden und Grundwasserwärmepumpen benötigen eine wasserrechtliche Zulassung des Landkreises für die Tiefenbohrung. Bei einer Bohrtiefe über 100 Metern ist dazu eine bergrechtliche Genehmigung einzuholen.
Zur Sicherheit sollten bei allen Wärmepumpen regionale Bestimmungen und denkmalrechtliche Vorschriften geprüft werden. Grundsätzlich müssen die vorgeschriebenen Mindestabstände zu den Nachbarn und die Lärmschutzbestimmungen eingehalten werden. Außerdem müssen alle Wärmepumpen beim Netzbetreiber angemeldet werden.
Gut zu wissen
Unsere Enpal-Experten gehen die komplette Planung Ihrer Wärmepumpe vorab mit Ihnen durch und übernehmen auch die Anmeldung beim Netzbetreiber.
Welche Größe sollte die Wärmepumpe haben?
Größe und Leistung der Wärmepumpe richtig zu berechnen, ist essenziell – so wie bei jeder anderen Heizung. Andernfalls drohen ineffizienter und teurer Betrieb, unnötig hohe Kosten und eine kürzere Lebensdauer der Anlage. Im Durchschnitt hat eine Wärmepumpe für ein Einfamilienhaus eine Leistung zwischen 5 und 16 kW.
Der wichtigste Faktor für die Berechnung der Wärmepumpe ist die Heizlast. Sie gibt an, welche Leistung ein Heizsystem erbringen muss, um einen Haushalt mit Wärme zu versorgen. Beeinflussende Faktoren sind u. a. die zu beheizende Fläche, der Dämmzustand des Gebäudes und die Art der Heizkörper. Die Leistung der Wärmepumpe sollte etwa der berechneten Heizlast entsprechen.
Es gibt eine simple Faustformel, um die Größe der Wärmepumpe zu berechnen:
Wohnfläche in m² × spezifischer Wärmebedarf in kW/m² = Heizlast in kW
Wenn Sie Ihren Wärmebedarf nicht kennen, finden Sie in der nachstehenden Tabelle Richtwerte je nach Gebäudeart:
Der Formel folgt auch unser praktischer Rechner, bei dem bereits Werte für den spezifischen Wärmebedarf je nach Haustyp hinterlegt sind.
Einfach Wohnfläche eingeben, Haustyp auswählen und eine erste Orientierung zur benötigten Leistung der Wärmepumpe bekommen.
Um die Leistung der Wärmepumpe für Ihr Haus zu berechnen, fügen Sie in das blaue Feld die Quadratmeterzahl Ihrer Wohnfläche ein und wählen Sie im gelben Feld Ihren Haustyp aus. Im grünen Feld erscheint dann die nötige Leistung der Wärmepumpe.
Finden Sie hier weitere Informationen zu der richtigen Größe einer Wärmepumpe und spezifische Angaben zu den einzelnen kW-Leistungen hier: Wärmepumpe richtig dimensionieren
Wärmepumpe mit Solar: Eine sinnvolle Kombination?
Die Wärmepumpe mit einer Solaranlage zu verbinden, ist eine sehr gute Idee. Die Traumkombination aus Wärmepumpe und Photovoltaik ermöglicht es, für den Betrieb der Wärmepumpe quasi kostenlosen Strom vom eigenen Dach zu nutzen. Das verringert nicht nur die Energiekosten um bis zu 75 %, sondern spart auch noch mehr CO₂. Günstiger und nachhaltiger geht es kaum.
Neben der Kombination mit Photovoltaik kann die Wärmepumpe auch mit Solarthermie verbunden werden. In diesem Fall wird zusätzlich Wärme erzeugt, was die Wärmepumpe entlastet. Die so generierte Wärme wird entweder direkt zum Heizen oder für die Warmwasserbereitung genutzt. Das lohnt sich im Normalfall aber nicht so sehr, wie die Kombination mit Photovoltaik. Warum das so ist, verraten wir hier: Wärmepumpe mit Solarthermie
Eine weitere Kombinationsmöglichkeit, über die sich Wärmepumpen-Interessenten Gedanken machen sollten, ist die Verbindung aus Wärmepumpe und Pufferspeicher. Zwar ist bei modernen, gut ausgesteuerten Anlagen ein Pufferspeicher nicht mehr zwingend erforderlich. Er kann der Wärmepumpe jedoch etwas mehr Flexibilität verleihen.
Welche Punkte gibt es bei der Planung der Wärmepumpe zu beachten?
Sobald feststeht, dass eine Wärmepumpe das neue Heizsystem sein soll und auch die Wärmequelle klar ist, gibt es noch weitere Aspekte, die in die Planung der Wärmepumpe mit einbezogen werden sollten. Unter anderem sind das:
- JAZ der Wärmepumpe
- Größe/Leistung der Wärmepumpe
- Kältemittel
- Betriebsweise
- Zertifizierungen
- Lautstärke
- Kühlfunktion
- Kombination mit Photovoltaik
Nutzen Sie auch unsere praktische Checkliste, um bei der Planung der Wärmepumpe an alles zu denken. Einfach auf das Bild klicken!
Häufig gestellte Fragen zu Voraussetzung & Planung von Wärmepumpen
Braucht man eine Wärmepumpenversicherung?
Eine spezielle Versicherung für die Wärmepumpe ist keine Pflicht und meistens auch nicht nötig.
Im Normalfall ist die Wärmepumpe nämlich von der Wohngebäudeversicherung abgedeckt. Man sollte den Versicherungsgeber jedoch auf jeden Fall über die Anschaffung der Wärmepumpe informieren, um sicherzustellen, dass sie wirklich in der Versicherung berücksichtigt wird.
Bei Bedarf kann man eine spezielle Wärmepumpenversicherung abschließen. Das ist jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden und sollte vor Abschluss genau geprüft werden.
Kann man eine Wärmepumpe auf dem Dach oder dem Dachboden installieren?
Theoretisch ist es möglich, eine Wärmepumpe auf dem Dach oder dem Dachboden zu installieren. Dafür müssen aber viele Voraussetzungen erfüllt sein.
Aufgrund des komplizierten Einbaus und vieler Nachteile wird eine Wärmepumpe in der Regel nicht auf dem Dach oder dem Dachboden verbaut.
Auch Enpal verbaut keine Wärmepumpen auf dem Dach oder Dachboden.
Kann man eine Wärmepumpe im Keller installieren?
Es ist grundsätzlich möglich, die Wärmepumpe im Keller zu installieren. Auf den ersten Blick bietet diese Aufstellungsart zahlreiche Vorteile, wie den Schutz vor Witterungseinflüssen. Doch es gibt auch zahlreiche Nachteile, wie z. B. Feuchtigkeitsprobleme oder eine erschwerte Zugänglichkeit.
Wichtig: Enpal verbaut keine Wärmepumpen im Keller.
Wie kann ich die Wärmepumpe verstecken oder verkleiden?
Moderne Wärmepumpen müssen eigentlich nicht versteckt oder verkleidet werden, da sie optisch schlicht und ansprechend gehalten sind. Wer sich dennoch dafür entscheidet, muss darauf achten, die Funktionalität der Wärmepumpe nicht zu beeinträchtigen.
Alle Informationen finden Sie in diesen Artikeln:
Wärmepumpe Installation & Betrieb: Das Wichtigste in Kürze
- Die Installation der Wärmepumpe erfolgt in den meisten Fällen innerhalb weniger Schritte.
- Die Inbetriebnahme ist unkompliziert: Unsere Techniker bereiten alles vor und weisen Sie dann umfassend ein.
- Im laufenden Betrieb sind in der Regel keine manuellen Eingriffe nötig.
- Die Wärmepumpe sollte regelmäßig gewartet werden, im Idealfall alle 1-3 Jahre.
Von Anschluss und Anmeldung bis hin zu Betrieb und Wartung: Wir erklären, was man zur Installation von Wärmepumpen wissen und im laufenden Betrieb beachten muss.
Wie wird eine Wärmepumpe angeschlossen?
Die Installation einer Wärmepumpe hat je nach Art der Wärmepumpe verschiedene Schritte. Die Luftwärmepumpe hat den einfachsten Installationsprozess:
- Standort bestimmen: Meistens im Garten oder an anderen Orten rund ums Haus.
- Alte Heizung ausbauen: Bevor der Einbau der neuen Wärmepumpe beginnen kann, muss die alte Heizung ausgebaut werden. In manchen Fällen müssen auch alte Heizkörper ausgetauscht werden.
- Wärmepumpe installieren: Dazu gehören das Fundament für die Außeneinheit, die Kernbohrung für die Hauseinführung und der Anschluss an das Heizsystem.
- Inbetriebnahme und hydraulischer Abgleich: Im letzten Schritt wird die komplette Anlage mit Heizungswasser gefüllt, eingeschaltet und anschließend durch einen hydraulischen Abgleich optimiert.
Wie genau die Installation abläuft, welche Tipps die Installation erleichtern und wieso man eine Wärmepumpe auf keinen Fall selbst installieren sollte, erklären wir in diesem Artikel: Wärmepumpe Installation
Wie wird die Wärmepumpe in Betrieb genommen?
Sobald die Wärmepumpe installiert und beim Netzbetreiber angemeldet ist, kann sie in Betrieb genommen werden.
Dazu überprüfen die professionellen Installateure noch einmal die Hydraulik, die Leitungen, den Kondensatablauf und die Dichtheit der Anlage. Die Wärmepumpe wird richtig eingestellt, es wird ein Inbetriebnahmeprotokoll erstellt und der Kunde wird in die Bedienung der Wärmepumpe eingewiesen. Danach läuft die Anlage automatisch, manuelle Eingriffe sind in der Regel nicht notwendig.
Wichtig: Die Inbetriebnahme sollte immer durch einen Fachbetrieb wie Enpal erfolgen.
Wie hoch ist der Stromverbrauch einer Wärmepumpe?
Grundsätzlich kann man jährlich von 20 bis 50 kWh Stromverbrauch pro Quadratmeter Wohnfläche ausgehen. Auf den Monat gerechnet entspricht das etwa 1,6 bis 4,2 kWh.
Der Stromverbrauch der Wärmepumpe ist an ihre Effizienz gekoppelt: Je effizienter die Wärmepumpe arbeitet, desto weniger Strom verbraucht sie.
Ein weiterer Faktor ist der Wärmebedarf des Hauses. Dafür sind vor allem die Wohnfläche, die Dämmung und die Vorlauftemperatur bzw. die Heizkurve relevant. Ebenso ist wichtig, wie viel Warmwasser erzeugt werden soll und wie hoch die gewünschte Raumtemperatur ist.
Für ein beispielhaftes Einfamilienhaus mit 120 m² Wohnfläche könnten Stromverbrauch und Stromkosten so aussehen:
Weitere Beispielrechnungen und mehr Informationen zu Stromverbrauch und den monatlichen Kosten einer Wärmepumpe finden Sie hier: Wie hoch sind die Betriebskosten einer Wärmepumpe?
Es ist übrigens möglich, einen speziellen Wärmepumpen-Stromtarif zu nutzen. Dieser kann bis zu 20 Cent pro Kilowattstunde günstiger sein als normaler Haushaltsstrom.
Noch günstiger wird es, wenn Sie Ihre Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage kombinieren und den quasi kostenlosen Solarstrom vom eigenen Dach nutzen.
Schon gewusst? Mit Enpal können Sie den günstigsten Stromtarif Deutschlands ab 16 Cent pro kWh nutzen.
Wartung einer Wärmepumpe: Wie oft und was kostet sie?
Die Wartung einer Wärmepumpe sollte regelmäßig stattfinden. Die meisten Hersteller empfehlen Intervalle von 1 bis 3 Jahren.
Eine gesetzliche Vorschrift zur Wartung gibt es nicht, es sei denn, die Wärmepumpe führt über 3 kg Kältemittel (sehr selten in Privathaushalten). Meistens wird sie jedoch von den Herstellern zur Garantiegewährung verlangt.
Bei der Wartung werden der Kältemittelkreislauf und die mechanischen Komponenten überprüft, außerdem werden Filter und andere Teile gereinigt. Das erhöht die Lebensdauer und Effizienz der Wärmepumpe.
Die Kosten für die Wartung liegen in der Regel zwischen 300 und 500 € pro Jahr. Der genaue Preis ist abhängig von Typ, Modell und Umfang. Dazu kommen eventuelle Kosten für Reparaturen, Ersatzteile o. ä.
Gut zu wissen: Auch bei Enpal können Sie eine regelmäßige Wartung der Wärmepumpe dazubuchen. Unsere Techniker stellen sicher, dass Ihre Enpal Wärmepumpe stets einwandfrei funktioniert.
Häufig gestellte Fragen zu Installation & Betrieb von Wärmepumpen
Braucht jede Wärmepumpe ein Fundament?
Mit einem Wärmepumpen-Fundament wird sichergestellt, dass das Außengerät einer Wärmepumpe waagerecht und sicher steht. Es ist nicht immer zwingend notwendig, aber wird in den meisten Fällen standardmäßig errichtet, um den sicheren Betrieb der Wärmepumpe zu gewährleisten.
Braucht die Wärmepumpe eine Verkleidung?
Nein, eine Wärmepumpe braucht keine Verkleidung. Sollte man sich doch dafür entscheiden, muss man darauf achten, dass die Verkleidung eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet, um die Effizienz des Systems nicht zu beeinträchtigen. Außerdem sollte sie wetterfest sein.
Darf man eine Wärmepumpe selbst einbauen?
Ja, grundsätzlich ist es erlaubt, eine Wärmepumpe selbst zu installieren. Ratsam ist das aber nicht: Es drohen Sicherheitsrisiken, Garantieverlust und sogar der Förderungswegfall. Mehr dazu hier: Wärmepumpe selbst einbauen
Achtung:
Aufgrund diverser Risiken und Gefahren raten wir stark vom selbständigen Einbau einer Wärmepumpe ab!
Wie lange ist die Lieferzeit einer Wärmepumpe von Enpal?
Bei Enpal beträgt die Lieferzeit der Wärmepumpe nur wenige Wochen. In der Regel können wir einen Installationstermin vier Wochen nach Bestellung anbieten.
Wärmepumpe im Altbau: Das Wichtigste in Kürze
- Eine Wärmepumpe ist in den meisten Altbauten machbar.
- Je besser die Dämmung und je größer die Heizkörper, desto eher lohnt sich eine Wärmepumpe.
- In der Anschaffung kostet eine Wärmepumpe im Altbau in der Regel nicht mehr als eine Wärmepumpe im Neubau.
- Die monatlichen Stromkosten liegen im Vergleich zum Neubau meistens etwas höher. Im Vergleich zur Gas- oder Ölheizung lohnt sich die Wärmepumpe aber trotzdem.
Hartnäckig hält sich der Mythos, dass sich Wärmepumpen im Altbau nicht lohnen. Das stimmt aber nicht: Wärmepumpen können durchaus in älteren Gebäuden funktionieren und das unter Umständen sogar mit den bestehenden Heizkörpern. Wir erklären, was es zu beachten gilt.
Ist eine Wärmepumpe in jedem Altbau möglich?
Grundsätzlich gilt: Für den effizienten Einsatz einer Wärmepumpe (und übrigens auch jedes anderen Heizsystems) sind bestimmte bauliche und technische Voraussetzungen wichtig. Und die hängen nicht von Alter und Optik, sondern vom Zustand des Hauses ab.
Aktuell sind in Deutschland gut 75 % der Wohngebäude für eine Wärmepumpe geeignet, darunter viele Altbauten. Das Baujahr des Hauses ist zwar nicht der entscheidende Faktor, aber oft ein guter Indikator dafür, wie sinnvoll eine Wärmepumpe im Altbau ist. Die folgende Tabelle gibt einen ersten Überblick:
Am Ende sollte immer ein Fachbetrieb entscheiden, ob und unter welchen Umständen eine Wärmepumpe sinnvoll ist. Lassen Sie sich dazu unverbindlich von unseren Enpal-Experten beraten.
Mit welchen Heizkörpern kann man eine Wärmepumpe im Altbau betreiben?
Grundsätzlich gilt: Je größer die Fläche des Heizkörpers, desto besser gibt er die Wärme auch bei geringer Vorlauftemperatur an den Raum ab. Daher eignen sich am besten großflächige Heizkörper für eine Wärmepumpe. Dazu gehören vor allem Plattenheizkörper, Flächenheizungen (Fußboden oder Wand) und Niedertemperaturheizkörper.
Abhängig von den individuellen Gegebenheiten kann auch eine Wärmepumpe ohne Fußbodenheizung betrieben werden. Es kann aber ebenso sinnvoll sein, eine Fußbodenheizung nachrüsten zu lassen.

Die Tabelle unten gibt einen ersten Überblick über die Eignung der Heizkörper. Genauere Informationen haben wir in diesem Artikel aufbereitet: Heizkörper für Wärmepumpe im Altbau
Welche Vorlauftemperatur braucht eine Wärmepumpe im Altbau?
Eine Wärmepumpe arbeitet bei niedrigen Vorlauftemperaturen um 35 °C am effizientesten. Im Altbau können aber höhere Temperaturen von 55 °C oder mehr notwendig sein, um die benötigte Wärme zu erzeugen. Besonders bei fehlender oder nur geringer Dämmung und kleinen Heizkörpern ist das der Fall.
Ist eine noch höhere Vorlauftemperatur von 70 °C nötig, kann auch eine Hochtemperatur-Wärmepumpe zum Einsatz kommen. Diese ist jedoch teurer in der Anschaffung und schlägt auch mit höheren Stromkosten zu Buche. Ein Fachbetrieb kann einschätzen, ob und wie eine Wärmepumpe im Altbau sinnvoll betrieben werden kann. Lassen Sie sich dazu von unseren Enpal-Experten beraten.
Tipp
Sie können mit einem einfachen Test herausfinden, ob sich eine Wärmepumpe grundsätzlich für Ihr Zuhause eignet. Dieser sollte an mehreren, aufeinander folgenden Tagen bei kalten Außentemperaturen durchgeführt werden.
Schritt 1: Stellen Sie die Vorlauftemperatur Ihrer aktuellen Heizung auf 50-55 °C und schalten Sie die Nachtabsenkung aus.
Schritt 2: Drehen Sie die Thermostate an den Heizkörpern auf Stufe 3, das entspricht etwa 20 °C.
Schritt 3: Beobachten Sie, ob die Räume ausreichend warm werden.
Ist das der Fall, ist Ihr Zuhause wahrscheinlich für eine Wärmepumpe geeignet. Ist das nicht der Fall, heißt das nicht zwingend, dass für das Gebäude keine Wärmepumpe infrage kommt. Gegebenenfalls müssen dann aber die Heizkörper ausgetauscht oder Sanierungen vorgenommen werden.
Wie hoch sind die Kosten für eine Wärmepumpe im Altbau?
An sich unterscheiden sich die Kosten für eine Wärmepumpe im Altbau nicht sonderlich von denen einer Wärmepumpe im Neubau. Grob ist mit rund 30.000 € für die Anschaffung und rund 300 - 500 € jährlich für die Wartung zu rechnen. Allerdings kann es sein, dass im Altbau zusätzliche Kosten für eine komplette oder teilweise energetische Sanierung dazukommen.
Die Stromkosten dürften für eine Wärmepumpe im Altbau hingegen eher im oberen Bereich liegen, abhängig von Dämmstandard, Größe des Hauses und Heizsystem. Auch die JAZ der Wärmepumpe und der Stromtarif sind relevant. Als Faustregel kann man jährlich von 40 bis 50 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche ausgehen.
Ein Rechenbeispiel und weitere Informationen finden Sie hier: Wie viel kostet eine Wärmepumpe im Altbau?
Häufig gestellte Fragen zu Wärmepumpen im Altbau
Lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau?
Ja, eine Wärmepumpe lohnt sich oft auch im Altbau. Da jeder Altbau anders ist, kommt es immer auf die individuelle Situation an.
Wichtige Faktoren dabei sind unter anderem der Dämmstandard, der Heizbedarf und die Art der Heizkörper. Alle Faktoren haben wir im Detail in diesem Artikel erklärt: Wärmepumpe im Altbau
Gut zu wissen: Der Mythos, dass sich Wärmepumpen im Altbau nicht lohnen, wurde sogar vom Fraunhofer ISE in einer Studie untersucht und widerlegt. Vier Jahre lang wurden Bestandsgebäude untersucht mit dem Ergebnis, dass das Alter eines Gebäudes keine Auswirkungen auf den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe hat.
Funktioniert eine Wärmepumpe im Altbau ohne Dämmung?
Eine Wärmepumpe im Altbau ohne Dämmung ist grundsätzlich möglich. Allerdings muss hier genau geprüft werden, ob die Wärmepumpe trotz fehlender Dämmung noch effizient und damit kosteneffektiv arbeiten kann. Oft ist es sinnvoll, einige Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen.
Welche ist die beste Wärmepumpe für den Altbau?
Die beste Wärmepumpe für den Altbau ist in der Regel eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Sie lässt sich einfach und schnell installieren, braucht verhältnismäßig wenig Platz, ist genehmigungsfrei und arbeitet auch bei Minusgraden effizient.
Funktioniert eine Wärmepumpe im Reihenhaus?
Eine Wärmepumpe funktioniert sehr gut in einem Reihenhaus. Denn Reihenhäuser haben meistens einen geringeren Wärmebedarf als freistehende Häuser. Das steigert die Effizienz der Wärmepumpe.
Sofern eine ausreichend gute Dämmung und genügend Platz zum Aufstellen der Wärmepumpe vorhanden ist, ist die Wärmepumpe eine sehr gute Option zum Heizen im Reihenhaus.
Alle Informationen haben wir hier noch einmal für Sie zusammengefasst: Wärmepumpe im Reihenhaus
Wärmepumpe vs. Gasheizung: Das Wichtigste in Kürze
- Eine Wärmepumpe hat vor allem langfristig viel mehr Vorteile als eine Gasheizung.
- Wer eine funktionsfähige Gasheizung auf eine Wärmepumpe umrüstet, sichert sich zusätzlich 20 % Förderung vom Staat.
- Man kann Wärmepumpe und Gasheizung auch kombinieren. Empfehlenswert ist diese Hybridheizung aber in den seltensten Fällen.
- Eine gut eingestellte Wärmepumpe verursacht im laufenden Betrieb bis zu 45 % weniger Kosten als eine Gasheizung.
Seit 2025 ist die Wärmepumpe die beliebteste Heizung in deutschen Eigenheimen. Dementsprechend überlegen immer mehr Haushalte von Gas auf Wärmepumpe umzusteigen. Wir verraten Ihnen, was es zu beachten gilt, was es kostet und ob sich Gasheizung und Wärmepumpe kombinieren lassen.
Vergleich Wärmepumpe und Gasheizung: Kosten & Rechner
Die Kosten für beide Heizsysteme sind unterschiedlich hoch. Vergleicht man die Betriebskosten einer Wärmepumpe mit denen einer Öl- oder Gasheizung, wird schnell klar, dass sich die Wärmepumpe langfristig lohnt und Heizkosten spart.
Es ist ratsam, jeweils die individuelle Situation durchzurechnen. Nutzen Sie unseren Rechner, um zu erfahren, wie viel Geld (und wie viel CO₂) Sie bei der Nutzung einer Wärmepumpe gegenüber einer Gasheizung sparen könnten. Geben Sie dazu einfach Ihren Wärmebedarf ein.
Wichtig: Die vom Rechner ausgegebenen Werte sind Schätzungen. Unsere Enpal-Experten beraten Sie gerne individuell.
Wie schnell amortisiert sich eine Wärmepumpe gegenüber einer Gasheizung?
Eine Wärmepumpe amortisiert sich gegenüber einer Gasheizung oft nach 8 bis 15 Jahren. Dann hat man die anfänglichen Investitionskosten durch die Einsparungen der Wärmepumpe wettgemacht.
Die genaue Amortisationszeit einer Wärmepumpe hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und den aktuellen Energiepreisen ab. Mit Erhöhung des Gaspreises und der CO₂-Steuer wird sich eine Wärmepumpe gegenüber einer Gasheizung zukünftig noch schneller amortisieren.
Einen Rechner und weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: Amortisation Wärmepumpe
Was ist besser: Wärmepumpe oder Gasheizung?
Bei der Frage Wärmepumpe oder Gasheizung kann es nur eine richtige Antwort geben: Wärmepumpen sind vor allem langfristig die effizientere, günstigere und umweltfreundlichere Wahl.
Das wird auch mit einem Blick auf die Vor- und Nachteile klar:
Wärmepumpe mit Gasheizung kombinieren: Möglich und sinnvoll?
Es ist möglich, eine (vorhandene) Gasheizung mit einer Wärmepumpe zu kombinieren und so günstiger, effizienter und nachhaltiger zu heizen. Wer sich für eine solche Hybridwärmepumpe entscheidet, reduziert seinen Gasverbrauch, ist weniger abhängig von den kontinuierlich steigenden Gaspreisen und senkt den CO₂-Ausstoß.
Sinnvoll ist dieser Schritt aber nicht: Das doppelte Heizsystem bedeutet nämlich auch doppelte Kosten, doppelte Wartung und doppelten Platzbedarf. Davon abgesehen wird es mit Blick auf Rohstoffverfügbarkeit, Gaspreisentwicklung und CO₂-Steuer auch immer teurer, eine fossile Heizung zu betreiben.
Ist die Gasheizung die primäre Wärmequelle, gibt es zudem keine Förderung für die Wärmepumpe. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), manchmal auch Heizungsgesetz, schreibt nämlich vor, dass neu eingebaute Heizungen mindestens 65 % der Wärme mit erneuerbaren Energien erzeugen müssen.
Eine Kombination aus Wärmepumpe und Gasheizung lohnt sich nur in Ausnahmefällen für Altbauten, in denen eine Wärmepumpe alleine den Wärmebedarf nicht decken kann. In den meisten Fällen ist es sinnvoller, sich komplett von der fossilen Heizung zu verabschieden und voll auf eine Wärmepumpe zu setzen.
Häufig gestellte Fragen zu Wärmepumpe vs Gasheizung
Gibt es Alternativen zur Gasheizung?
Wer ohne Gas und Öl heizen möchte, hat neben der Wärmepumpe noch weitere Heizungsarten als Alternativen. Dazu gehören:
Fakt ist jedoch: Eine kluge Alternative für die Wärmepumpe gibt es für Hausbesitzer aktuell nicht und wird dank der klaren Vorteile einer Wärmepumpe auch nicht benötigt.
Bei Enpal empfehlen wir aufgrund der einfachen Installation, der hohen Förderung und des sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Lohnt sich das Umrüsten einer Gasheizung auf eine Wärmepumpe?
Ja! Das Umrüsten zu einer Wärmepumpe bietet verschiedene Vorteile, darunter langfristige Kosteneinsparungen, Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit. Alleine die Heizkosten lassen sich mit einer Wärmepumpe um bis zu 45 % senken.
Wie das Umrüsten funktioniert, haben wir für die Ölheizung bzw. Gasheizung in diesen Artikeln erklärt:
Was kostet es, die Gasheizung auf Wärmepumpe umzurüsten?
Anschaffung, Installation und Inbetriebnahme einer Wärmepumpe kostet in der Regel zwischen 29.000 und 40.000 €. Für die Wartung sind jährlich etwa 300 - 500 € anzunehmen. Bei der Umrüstung von Gasheizung auf Wärmepumpenheizung kommen noch Entsorgungskosten für die alte Gasheizung in Höhe von etwa 2.000 € dazu.
Müssen für die Wärmepumpe auch die alten Heizkörper ausgetauscht werden, fallen auch dafür Zusatzkosten an. Aber gut zu wissen: Enpal übernimmt den Heizkörper-Tausch für seine Kunden!
Wer seine noch funktionsfähige Gasheizung gegen eine Wärmepumpe austauscht, sichert sich übrigens neben der Grundförderung von 30 % noch einmal 20 % Klimageschwindigkeitsbonus vom Staat! Wer dann noch auf ein natürliches Kältemittel wie Propan setzt, bekommt noch einmal 5 % und trägt somit nur noch weniger als die Hälfte der Kosten für die Wärmepumpe selbst.


Enpal Wärmepumpen-Monitor
Als eins der größten Energieunternehmen in Deutschland führt Enpal regelmäßig Datenanalysen rund um das Thema Wärmepumpe durch und präsentiert diese im Enpal Wärmepumpen-Monitor. Dabei werden verschiedenste Fragen beantwortet - von "Wie viele Wärmepumpen wurden in Deutschland installiert?" über "Wie groß ist der Personalbedarf für die Energiewende eigentlich?" bis hin zu "Kann man beim Winterwetter in Deutschland mit einer Wärmepumpe heizen?". Klicken Sie sich einfach in die Analyse, die Sie interessiert.
Wärmepumpen-Monitor 2025
90 Prozent aller Eigenheimbesitzer würden bei einem Heizungswechsel eine Wärmepumpe wählen. Die Beliebtheit dieses Heizsystems bleibt damit ungebrochen, während sich falsche Vorurteile immer noch hartnäckig halten. Unsere aktuelle Umfrage unter insgesamt 6.500 Eigenheimbesitzern in Deutschland zeigt, bei welchen Aspekten rund um die Wärmepumpe immer noch Aufklärungsbedarf besteht.
Die Wärmepumpe bleibt an der Spitze
Neben der hohen Zufriedenheit derjenigen, die bereits eine Wärmepumpe nutzen (rund 90 Prozent), ist sie auch insgesamt die bevorzugte Heizoption unter Hausbesitzern. Ein Drittel der Eigenheimbesitzer ohne Wärmepumpe würde sich bei einem Austausch der Heizung für die Wärmepumpe entscheiden. Gas (25 Prozent) und Öl (8 Prozent) erzielen deutlich geringere Beliebtheit.
Mythen stehen Faktenlage weiter gegenüber
Besonders unter Hausbesitzern, die keine Wärmepumpe haben, halten sich weiterhin Vorurteile. 65 Prozent der Befragten nennen hohe Anschaffungskosten als das größte Hindernis, dahinter folgen Sorgen um die baulichen Veränderungen (47 Prozent) sowie hohe Betriebskosten (42 Prozent).
Demgegenüber stehen die positiven Erfahrungen der Wärmepumpenbesitzer: Sie schätzen vor allem die geringeren Energiekosten (73 Prozent), die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen (57 Prozent) und die Wertsteigerung ihrer Immobilie (43 Prozent).
Staatliche Förderung ist noch weitgehend unbekannt
Die Ergebnisse spiegeln größtenteils das Stimmungsbild aus unserer Umfrage vom vorherigen Jahr wider. Das gilt auch für den Kenntnisstand zur Wärmepumpen-Förderung: Jeder zweite Hausbesitzer ohne Wärmepumpe kennt kein einziges Förderprogramm (wie z. B. KfW, BAFA oder sogar regionale Fördermöglichkeiten), obwohl die Anschaffungskosten die größte Sorge darstellen. Die Aufklärung rund um die Vorteile sowie Informationen zur Anschaffung von Wärmepumpen bleibt damit eines unserer zentralen Anliegen.
Über den Enpal Wärmepumpen-Monitor
Die repräsentative Umfrage wurde im Zeitraum vom 03. September bis 23. September 2025 durchgeführt. Befragte Grundgesamtheit (Stichprobengröße): Eigenheimbesitzer (2.500) / Eigenheimbesitzer, die nicht mit Wärmepumpe heizen (2.500) / Eigenheimbesitzer, die mit Wärmepumpe heizen (1.500).
Wie heizt Deutschland? Und wie hoch sind die Mehrkosten durch die CO₂-Bepreisung?
Die Heizmethoden in Deutschland könnten unterschiedlicher nicht sein: Während in Wilhelmshaven fast jeder Haushalt mit Gas heizt, setzt Flensburg fast vollständig auf Fernwärme und ist damit nahezu unabhängig von Gas. Das zeigt unsere Analyse der 150 größten Städte und ihrer gängigsten Heizarten: von Gas, Fernwärme, Heizöl, Holz und Kohle bis zu grünen Alternativen wie Wärmepumpen, Solarthermie, Biomasse und Biogas. Auffällig: In nordrhein-westfälischen Städten – allen voran Paderborn – kommen besonders häufig Wärmepumpen und Solarthermie zum Einsatz. In Schwäbisch-Gmünd dagegen wird deutlich öfter mit Heizöl geheizt – fast dreimal so häufig wie im Bundesdurchschnitt.
Heizgewohnheiten in Deutschland: Gas klar vorn
Rund 63,7 Prozent der Haushalte in Deutschland heizen mit Gas. Dahinter folgt Fernwärme mit 20,4 Prozent. Heizöl nutzen 10,3 Prozent, Strom 1,9 Prozent. Wärmepumpen und Solarthermie machen 1,8 Prozent aus, Holz 1,3 Prozent. Kohle liegt bei 0,15 Prozent, Biomasse und Biogas bei 0,06 Prozent.
Die Daten sind im Einzelnen nochmal hier aufgeschlüsselt:
NRW-Städte heizen am liebsten mit Wärmepumpen und Solarthermie
Paderborn liegt beim Einsatz von Wärmepumpen und Solarthermie ganz vorn: Im Schnitt nutzen 5,1 Prozent der Haushalte diese umweltfreundlichen Heizarten – Platz eins im Städtevergleich. Dahinter folgen Trier mit 4,8 Prozent und Bocholt mit 4,7 Prozent. Auch Euskirchen (4,5 Prozent) und Dormagen (4,4 Prozent) schaffen es in die Top fünf. Ganz anders sieht es am unteren Ende des Rankings aus: In Bremen, Offenbach am Main und Neubrandenburg liegt der Anteil gerade einmal bei 0,5 Prozent – in Flensburg und Wilhelmshaven sogar nur bei 0,4 Prozent.
Wärmepumpen und Solarthermie gehören zu den beliebtesten klimafreundlichen Alternativen zu fossilen Heizmethoden. Auch Biomasse und Biogas zählen dazu – werden allerdings deutlich seltener genutzt. Selbst der Spitzenreiter Ingolstadt kommt hier nur auf 1,1 Prozent. Bundesweit liegt der Durchschnitt bei gerade einmal 0,06 Prozent – damit sind Biomasse und Biogas die am seltensten genutzten nachhaltigen Heizformen.
Diese Städte setzen am stärksten auf erneuerbare Heizformen:
Gas bleibt die Nummer eins – mit teils riesigen Unterschieden
Trotz aller Alternativen ist Gas in Deutschland nach wie vor die meistgenutzte Heizart – auch wenn der Blick auf die Städte große Unterschiede zeigt. In Wilhelmshaven heizen ganze 94,7 Prozent der Haushalte mit Gas – Platz eins im Ranking. Oldenburg folgt mit 93,1 Prozent, dicht dahinter liegt Delmenhorst mit 89,5 Prozent. Auch Neuwied (87,1 Prozent) und Witten (84,9 Prozent) gehören zu den Städten mit dem höchsten Gasanteil. Ganz anders sieht es in Flensburg aus: Hier nutzen gerade einmal 4,3 Prozent Gas zum Heizen – das sind über 90 Prozent weniger als in Wilhelmshaven. Auch in Wolfsburg (6,9 Prozent) und Neubrandenburg (19,5 Prozent) spielt Gas nur eine Nebenrolle.
In diesen deutschen Städten wird primär Gas als Energiequelle genutzt:
Fernwärme top, Heizöl flop – je nach Stadt
Fernwärme ist mit über 20 Prozent bundesweit auf Platz zwei der Heizarten – in Flensburg sogar bei 93 Prozent. Auch Wolfsburg (81,2 Prozent) und Neubrandenburg (78,3 Prozent) liegen weit über dem Schnitt. Kaum eine Rolle spielt Fernwärme dagegen in Mönchengladbach und Rheine (je unter einem Prozent). Heizöl ist in Schwäbisch-Gmünd besonders verbreitet (28,1 Prozent) – in Rostock dagegen fast gar nicht (0,4 Prozent).
Regionale Ausreißer: Wo Kohle und Holz noch eine größere Rolle spielen
Kohle wird insgesamt nur noch selten als Energiequelle genutzt – bundesweit liegt ihr Anteil bei lediglich 0,15 Prozent. In einigen Städten ist sie jedoch noch vergleichsweise stark vertreten: In Dorsten nutzen 3,2 Prozent der Haushalte Kohle zum Heizen, in Heidelberg sind es 3,1 Prozent und in Herten 1,3 Prozent. Deutlich verbreiteter ist Holz als Energieträger: Bundesweit liegt der Anteil bei 1,3 Prozent, in einigen Städten jedoch deutlich darüber. Spitzenreiter ist Schwäbisch Gmünd mit 7,5 Prozent, gefolgt von Aalen (6 Prozent) und Villingen-Schwenningen (5,7 Prozent).
Die Tabelle veranschaulicht die prozentualen Anteile von Fernwärme, Heizöl, Holz und Kohle:
Heizen in Deutschland: Von Gashochburgen bis Holzregionen
Nordrhein-Westfalen liegt bei der Nutzung von Wärmepumpen und Solarthermie mit durchschnittlich 2,21 Prozent vorn – deutlich mehr als in anderen Bundesländern. Gleichzeitig ist der Gasverbrauch dort mit 70,67 Prozent besonders hoch. In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern dominiert hingegen Fernwärme: über 50 Prozent in Brandenburg, fast 70 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern.
Baden-Württemberg und Bayern stechen durch vergleichsweise hohe Werte bei Holzheizungen (jeweils rund 3 Prozent) sowie bei Biomasse und Biogas (über 0,1 Prozent) hervor. Heizöl spielt ebenfalls vor allem in diesen beiden Bundesländern sowie in Bremen noch eine größere Rolle – mit Anteilen von 15,78 Prozent (Baden-Württemberg), 13,8 Prozent (Bremen) und 13,67 Prozent (Bayern). Kohle ist zwar insgesamt kaum noch relevant, erreicht in Sachsen aber mit 0,42 Prozent den höchsten Wert im bundesweiten Vergleich.
Diese Karte zeigt alle Heizarten der deutschen Bundesländer:
Mehrkosten durch CO₂-Bepreisung: Wer fossil heizt, zahlt drauf
Das neue europäische Emissionshandelssystem (ETS-2) bringt sowohl für Vermieter als auch für Mieter von unsanierten Gebäuden erhebliche finanzielle Belastungen mit. Ab 2027 ersetzt das ETS-2 schrittweise den nationalen Emissionshandel (nEHS), sodass die CO₂-Bepreisung in diesen Bereichen künftig einheitlich auf EU-Ebene geregelt wird.
Um die finanziellen Auswirkungen für Mieter und Vermieter zu beziffern, haben wir die zusätzlichen Kosten mithilfe von unterschiedlichen CO₂-Preis-Szenarien und den dominierenden Heizarten Deutschlands errechnet.
Die Mehrkosten durch den Emissionshandel entstehen, indem der Energieverbrauch des Gebäudes mit dem jeweiligen Emissionsfaktor des Brennstoffs und dem geltenden CO₂-Preis multipliziert wird. So ergibt sich die jährliche Zusatzbelastung, die seit 2023 nach einem Stufenmodell zwischen Eigentümern und Mietern aufgeteilt wird: Je schlechter die energetische Qualität des Gebäudes, desto höher ist der Anteil, den die Vermieter tragen, bis zu 95 Prozent bei sehr ineffizienten Häusern. Bei energieeffizienten Gebäuden hingegen liegt die Hauptlast bei den Mietern. Eigenheimbesitzer tragen die Mehrkosten alleine.
Beim neuen Emissionshandelssystem (ETS-2) wird der CO₂-Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Experten erwarten einen CO₂-Preis zwischen 100 und 250 Euro pro Tonne CO₂ bis 2030, ab 2040 könnte der Preis sogar auf bis zu 400 Euro steigen. Im nationalen Gesetz liegt der CO₂-Preis in diesem Jahr noch bei 45 Euro pro Tonne, 2026 soll er bereits auf 55 Euro pro Tonne ansteigen.
Für die Berechnung der finanziellen Auswirkungen der steigenden CO₂-Preise haben wir drei verschiedene Szenarien erstellt:
- Szenario I: 55 Euro/Tonne CO₂
- Szenario II: 160 Euro/Tonne CO₂
- Szenario III: 250 Euro/Tonne CO₂
Aus diesen Szenarien ergeben sich folgende Mehrkosten für die Haushalte:
Über die Untersuchung
Für die Analyse wurden auf dem Klimadashboard verschiedene Heizarten der 150 größten Städte Deutschlands untersucht. Dabei zeigten Essen, Münster, Hamm, Hagen, Mülheim an der Ruhr keine validen, vergleichbaren Daten auf, weshalb die Liste um Unna, Langenfeld (Rheinland), Euskirchen, Göppingen und Hameln ergänzt wurde. Zu den analysierten Heizarten zählen: Gas, Fernwärme, Heizöl, Wärmepumpen- und Solarthermie, Holz, Kohle und Biomasse und Biogas.
Die Untersuchung basiert auf Emissionsfaktoren, die gemäß der Anlage 9 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ermittelt wurden. Für die Einstufung der Gebäude in die Energieeffizienzklassen C und G orientierte sich die Analyse an den Richtlinien von der Verbraucherzentrale.
Die Berechnung der Szenarien ergibt sich aus den Annahmen und Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (Szenario I: 55 Euro/Tonne CO₂), der Uni Köln (Szenario II: 160 Euro/Tonne CO₂) und dem PIK Potsdam (Szenario III: 250 Euro/Tonne CO₂). Für das Ausgangsszenario wurde eine Wohnung von 95 Quadratmetern angenommen.
Als Beispiel wurden die Energiewerte für Energieeffizienzklasse C und G berechnet. Nach Berechnung des Jahresbedarfs an kWh / Quadratmeter wurde der Energiebedarf mit dem Emissionsfaktor des entsprechenden Energieträgers multipliziert. Die berechneten Tonnen CO₂ wurden mit den Kosten der verschiedenen Szenarien erneut multipliziert, um auf die Jahresmehrkosten zu kommen.
Wissen und Vorurteile über Wärmepumpen
Das Wissen darüber, wie eine Wärmepumpe funktioniert und was der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten ist, ist unter Hausbesitzern ohne Wärmepumpe noch nicht weit verbreitet. Über 50 % können die Wärmepumpe nicht erklären und kennen auch den Unterschied zwischen Luft- und Erdwärmepumpe nicht.
Die Frage nach den aktuellen Fördermöglichkeiten macht klar: Trotz einjähriger Wärmepumpen-Debatte in den Medien und in der Politik fehlt das Basiswissen. Über 50 % der Eigenheimbesitzer ohne Wärmepumpe wissen nicht, dass die Heiztechnologie aktuell gefördert wird.
Wieso sollten Hausbesitzer mit einer Wärmepumpe heizen? Bei dieser Frage lohnt es sich, die Antworten in „von Eigenheimbesitzern ohne Wärmepumpe“ und „von Eigenheimbesitzern mit Wärmepumpe“ zu unterteilen.
Diejenigen, die bereits mit einer Wärmepumpe heizen, sehen klare Vorteile:
- Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen (ca. 56 %)
- Geringere Energiekosten (ca. 50 %)
- Umwelt- und Klimaschutz (ca. 49 %)
- Höherer Immobilienwert (ca. 41 %)
- Staatliche Förderung (ca. 24 %)
Im Gegensatz dazu sind die Vorteile unter Hausbesitzern, die noch nicht mit einer Wärmepumpe heizen, deutlich unbekannter:
- Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen (ca. 29 %)
- Geringere Energiekosten (ca. 17 %)
- Umwelt- und Klimaschutz (ca. 23 %)
- Höherer Immobilienwert (ca. 15 %)
- Staatliche Förderung (ca. 15 %)
Die Ergebnisse zeigen vor allem, dass Hausbesitzer ohne Wärmepumpe gar nicht wissen, dass sie mit einer Wärmepumpe viel Geld sparen und gleichzeitig den Wert der Immobilie erhöhen können. Der Informationsbedarf ist also immens.
Bedenken haben Eigenheimbesitzer ohne Wärmepumpe vor allem in Bezug auf vermeintlich hohe Anschaffungskosten (ca. 66 %), bauliche Veränderungen (ca. 49 %) und hohe Betriebskosten (ca. 45 %). Also bei Themen, die dank staatlicher Förderung, einfacher Installation der Luftwärmepumpe, der Kombination mit einer PV-Anlage und einem besonders günstigen Wärmepumpen-Stromtarif gelöst werden können. Auch bei der Leistung der Wärmepumpe scheinen sich alte Mythen zu halten: 44 % geben an, dass sie Bedenken bezüglich der Heizleistung einer Wärmepumpe bei niedrigen Temperaturen haben.
Die Informationsdefizite über Technologie und Förderprogramme sind erheblich. Daraus wachsen Bedenken bei vielen Hausbesitzern: Es besteht also noch erheblicher Aufklärungsbedarf.
Insgesamt wird deutlich, dass das Basiswissen unter Hausbesitzern ohne Wärmepumpe aktuell noch fehlt. Skepsis, Vorurteile und Mythen überwiegen, die klaren Fakten und Vorteile sind vor allem unter Hausbesitzern bekannt, die bereits mit einer Wärmepumpe heizen.
Enpal führte zusammen mit dem Marktforschungsunternehmen Civey eine repräsentative Umfrage unter Eigenheimbesitzern in Deutschland durch. Die Befragung erfolgte im Zeitraum vom 27.8.2024 - 11.9.2024. Befragt wurden 2.500 Eigenheimbesitzer.
Anschaffung und Zufriedenheit
Die Befragung zeigt, dass ca. 75 % der Hausbesitzer in Deutschland noch mit Gas oder Öl heizen. Dabei ist die Gasheizung mit Abstand am verbreitetsten: 53 % heizen mit dem fossilen Brennstoff. Die Ergebnisse verdeutlichen aber auch, dass die Wärmepumpe aufholt: Fast jeder zehnte deutsche Hausbesitzer heizt bereits mit der umweltfreundlichen Wärmepumpe.
Über 80 % der Eigenheimbesitzer planen aktuell nicht mit der Anschaffung einer Wärmepumpe – und das trotz der zahlreichen Vorteile, die eine Wärmepumpe im Vergleich zu anderen Heizsystemen bietet. Das zeigt, wie sehr die politische Debatte die Wärmepumpe in Mitleidenschaft gezogen hat.
Klar wird in der Befragung auch: Wer eine Wärmepumpe hat, ist sehr zufrieden damit. Das zeigen die Antworten der Eigenheimbesitzer, die bereits mit einer Wärmepumpe heizen. 9 von 10 Wärmepumpen-Betreibern sind mit ihrer Wärmepumpe zufrieden.
Enpal führte zusammen mit dem Marktforschungsunternehmen Civey eine repräsentative Umfrage unter Eigenheimbesitzern in Deutschland durch. Die Befragung erfolgte im Zeitraum vom 27.8.2024 - 11.9.2024. Befragt wurden 2.500 Eigenheimbesitzer.
Entwicklung der Wärmepumpen-Anzahl in Neubauten
Die Reform des Gebäudeenergiegesetzes hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt: Laut Gesetz sollen alle ab 2024 neu eingebauten Heizungen zu einem Großteil mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Aber wie ist der aktuelle Stand der Wärmewende in der Bundesrepublik? Wo läuft es gut, wo hakt es noch? Wir haben den Vergleich gemacht und die Entwicklung beim Anteil von Wärmepumpen in Neubauten zwischen 2017 und 2021 näher betrachtet. Demnach geht die Entwicklung je nach Stadt und Bundesland deutlich auseinander.
So hat sich der Ausbau von Wärmepumpen in den Bundesländern entwickelt
Die Wärmewende geht im flächenmäßig kleinsten Bundesland am schnellsten voran: Im Saarland werden 48 Prozent der Neubauten aus den letzten fünf Jahren mit einer Wärmepumpe geheizt. Ähnlich hoch ist der Anteil in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz mit 46,5 bzw. 45,4 Prozent. Auf dem vierten Platz landet Sachsen-Anhalt: 43,7 Prozent der fertiggestellten Gebäude heizen mit einer Wärmepumpe, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (35,8 Prozent).
Das Schlusslicht bilden hingegen die Stadtstaaten: Nur 7, 7,1 bzw. 7,8 Prozent der Heizungen in fertiggestellten Gebäuden in Bremen, Berlin und Hamburg werden mit Geo- bzw. Umweltthermie betrieben. Mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein landen zwei weitere norddeutsche Bundesländer weit hinten (19,9 bzw. 23,3 Prozent).
Einen Überblick über die genauen Zahlen in den Bundesländern bekommen Sie in dieser Tabelle:
Bremen liegt im Gesamtvergleich zwar weit hinten, dennoch hat sich der Ausbau in den letzten Jahren im Stadtstaat deutlich verstärkt: In 13,1 Prozent der Neubauten des Stadtstaates wurde eine Wärmepumpe eingebaut - fast eine Verdopplung im Vergleich zu 2017.
Deutlich ist die Entwicklung auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen: Um 74,4 bzw. 46 Prozent ist der Anteil an eingebauten Wärmepumpen in den letzten fünf Jahren gestiegen.
Langsamer geht es in Thüringen und Berlin voran, wo der Anstieg des Wärmepumpen-Anteils lediglich 11,5 bzw. 5,1 Prozent beträgt. Sogar zurückgegangen ist der Anteil an Neubauten mit Wärmepumpe in Hamburg: Der Anteil der Neubauten mit Wärmepumpe sank um mehr als 10 Prozent.
Alle Zahlen im Detail finden Sie hier:
So viele Haushalte werden bereits mit Wärmepumpe geheizt
Ein Blick auf die neuesten Zahlen aus 2022 zeigt: Nur 2,8 Prozent aller deutschen Haushalte heizen aktuell mit einer Wärmepumpe. Dabei gibt es durchaus Unterschiede zwischen den Bundesländern. Während Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz mit fast 4 Prozent deutlich über dem Durchschnitt liegen, hängen die beiden Stadtstaaten Berlin und Hamburg mit jeweils ca. 1 Prozent hinterher. Ähnlich gering ist der Anteil mit 1,7 Prozent in Thüringen.
Wie weit fortgeschritten der Ausbau in allen Bundesländern ist, erfahren Sie hier:
So hat sich der Ausbau von Wärmepumpen in den Städten entwickelt
Der Wärmewende-Vorreiter unter den deutschen Städten ist aktuell Bottrop: Fast 60 Prozent der neu gebauten Gebäude wurden hier zwischen 2017 und 2021 mit einer Wärmepumpe ausgestattet. Damit ist die im Ruhrgebiet gelegene Stadt Spitzenreiter beim Ausbau von Wärmepumpen. Auch in Mönchengladbach ist die Nutzung von Wärmepumpen mit anteilig 49,3 Prozent bei fertiggestellten Gebäuden und Wohnungen hoch. Auf dem dritten Platz landet Pirmasens (Rheinland-Pfalz) mit 48,2 Prozent. Die Top Fünf werden von Baden-Baden und Trier vervollständigt: Hier werden knapp die Hälfte aller Neubauten mit Wärmepumpen beheizt (46,3 bzw. 46,2 Prozent).
Den Anteil an Wärmepumpen in Neubauten je nach Stadt finden Sie in dieser Tabelle:
Schlusslicht im Städtevergleich ist Flensburg, Heimatort des Wirtschaftsministers Robert Habeck. In nur 113 von 3.026 fertiggestellten Gebäuden wärmen die Flensburger ihr Eigenheim mit Geo- bzw. Umweltthermie (3,7 Prozent). Ähnlich niedrig ist die Quote in Bremerhaven (4,0 Prozent). Ein Grund dafür: In Norddeutschland wird aufgrund der Nähe zum Wasser häufig mit Fernwärme geheizt.
Nicht nur beim Ausbau von Solaranlagen, auch beim Einbau von Wärmepumpen liegen Offenbach am Main und Frankfurt am Main weit hinten: In lediglich 6,4 bzw. 6,6 Prozent aller Neubauten wird mit einer Wärmepumpe geheizt. Mit einem Anteil von 7,1 Prozent folgt Emden im Ranking.
Obwohl die Anzahl an fertiggestellten Gebäuden mit Wärmepumpen in Emden ausbaufähig ist, hat die Stadt in den letzten Jahren den Ausbau bereits deutlich verstärkt: Während der Anteil 2017 bei 0,6 Prozent lag, sind es 2021 6,4 Prozent. Damit hat sich die Zahl in den vergangenen fünf Jahren verzehnfacht. Ähnlich hoch ist der Anstieg in Frankfurt am Main: Von anteilig 4,6 Prozent ist die Anzahl an Neubauten, die mit Wärmepumpen beheizt werden, auf 17 Prozent gewachsen – ein Plus von 452 Prozent.
Wie sich der Anteil an Wärmepumpen in den letzten fünf Jahren in allen Städten verändert hat, erfahren Sie hier:
So hat sich der Ausbau von Wärmepumpen in den Landkreisen entwickelt
Die Landkreise Trier-Saarburg, Neckar-Odenwald-Kreis und Bernkastel-Wittlich bilden die Spitze bei den Landkreisen: Anteilig 74,7, 74,4 bzw. 71,9 Prozent der Neubauten werden mit Wärmepumpen beheizt. Auch in der Eifel ist der Anteil hoch: In der Vulkaneifel und im Eifelkreis Bitburg-Prüm beträgt die Quote 68,2 bzw. 67,7 Prozent. Niedriger fallen die Zahlen im Norden aus. Mit Aurich, Wittmund und Leer belegen drei Landkreise nahe der Nordseeküste das Tabellenende (5,3 bzw. je 9,3 Prozent). Wie schneidet Ihr Landkreis ab? Das zeigt diese Grafik:
Auch bei den Landkreisen fällt auf, dass die Schlusslichter den Wärmepumpenausbau in den letzten Jahren deutlich intensiviert haben. Im Landkreis Wesermarsch und im Emsland hat sich der Anteil 2021 verglichen mit dem Einbau 2017 fast verdreifacht. Auch im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt geht der Anteil deutlich nach oben (plus 202 Prozent).
Hier können Sie einsehen, wie hoch die Differenz zwischen dem Anteil an eingebauten Wärmepumpen 2017 und 2021 in den Landkreisen ist:
Was haben wir untersucht?
Für die Analyse haben wir die Formen primär verwendeter Heizenergie in allen fertiggestellten Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden sowie in Wohnungen in Wohngebäuden von 2017 bis 2021 ermittelt. Daraufhin haben wir den Anteil an Gebäuden mit Umwelt- bzw. Geothermie erfasst und miteinander verglichen. Weitere Informationen zu den Bundesländern gehen aus dem Mikrozensus 2022 hervor.
Winterwetter in Deutschland
Mit einer Wärmepumpe im Winter effektiv heizen? Das geht auch bei minus 20 Grad Celsius noch. Solche starken Minusgrade erreicht man in Deutschland aber in der Regel sowieso nicht, wie unsere Winterwetter-Analyse zeigt. Während München in den Wintermonaten deutschlandweit mit den meisten Sonnenstunden glänzt, lockt Montreal all jene, die echte Minusgrade erleben möchten. Wir haben mit unserer Untersuchung die sonnigsten und frostigsten Orte ermittelt – in deutschen Städten ab 100.000 Einwohnern und acht internationalen Metropolen. Dafür wurden die Winterwetterdaten der Jahre 2000 bis 2023 unter die Lupe genommen.
Winterliche Highlights: München und Düsseldorf führen bei Sonne und Temperaturen
In München sind die Aussichten auf Sonne im Winter deutschlandweit am besten. Mit durchschnittlich 3,30 Sonnenstunden pro Tag ist die bayerische Landeshauptstadt die sonnigste Großstadt des Landes. Stuttgart folgt dicht dahinter mit 3,04 Stunden täglich, während auch Nürnberg mit 2,67 Stunden pro Tag einen sonnenreichen Winter genießen kann. Am wenigsten Sonne gibt es hingegen in Bielefeld: Hier zeigt sich die Sonne im Schnitt nur 1,84 Stunden pro Tag.
Die Temperaturen in der Winterzeit bleiben im Ruhrgebiet vergleichsweise mild. Düsseldorf führt das Ranking mit durchschnittlich 4,5 Grad an, gefolgt von Köln (4,2 Grad) und Dortmund (4,0 Grad). Nürnberg hingegen ist die kälteste Großstadt Deutschlands. Mit einem Durchschnitt von 2 Grad bleibt die Temperatur dort zwar deutlich unter dem bundesweiten Mittel, aber immer noch über dem Gefrierpunkt.
Hier sind alle Ergebnisse des Großstadt-Rankings:
Sonne und Wärme im Winter: Reutlingen und Solingen führen das Ranking an
In Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern sind Reutlingen und Solingen die Spitzenreiter im Winterwetter-Ranking. Während Deutschland im Schnitt nur 2,46 Sonnenstunden pro Tag im Winter verzeichnet, liegt Reutlingen weit darüber, mit 3,24 Stunden. Freiburg folgt mit 3 Stunden und Augsburg mit 2,94 Stunden. Auch die Temperaturen zeigen regionale Unterschiede: Wiesbaden ist die einzige deutsche Stadt, die in der kalten Jahreszeit tatsächlich Minusgrade erlebt (−0,5 Grad). Solingen hingegen bietet mit durchschnittlich 4,5 Grad die höchsten Temperaturen unter den Mittelstädten Nordrhein-Westfalens.
Diese Städte waren ebenfalls im Ranking:
Zürich führt das internationale Sonnen-Ranking an
Im internationalen Vergleich punktet Zürich mit durchschnittlich 2,92 Sonnenstunden pro Tag und liegt damit sogar über dem deutschen Durchschnitt. Während in Kopenhagen nur 2,40 Stunden pro Tag die Sonne scheint, landet Luxemburg mit 2,34 Stunden auf dem dritten Platz. Amsterdam fällt nicht nur durch viele Sonnenstunden auf, sondern auch durch milde Temperaturen, die im Winter durchschnittlich 4,4 Grad erreichen. Montreal hingegen bildet zusammen mit New York das Schlusslicht der Sonnenstunden ab (1,46 Stunden), punktet jedoch mit besonders niedrigen Temperaturen von minus 4,2 Grad.
Einen Überblick zu den internationalen Städten ist hier aufgeschlüsselt:
Das haben wir untersucht:
Für die Analyse wurden die durchschnittlichen Sonnenstunden und Temperaturen vom 21. Dezember bis 20. März von 2000 bis 2023 ermittelt. Analysiert wurden dabei alle deutschen Städten mit mindestens 100.000 Einwohnern sowie acht weitere internationale Großstädte. Für jede Stadt wurden die 100 nächstgelegenen Wetterstationen ermittelt. Stationen, die seit dem Jahr 2000 keine Daten zur Sonneneinstrahlung bzw. Temperaturen aufgezeichnet haben, wurden ausgeschlossen. Aus den verbleibenden Stationen wurden diejenigen ausgewählt, die am nächsten liegen und für mindestens 50 Prozent der untersuchten Tage Datensätze bereitstellen.
Fachkräftebedarf für die Energiewende
Zusammen mit Indeed hat Enpal die Energiewende-Berufe am Arbeitsmarkt untersucht. Das Ergebnis: Seit 2020 ist der Bedarf an Fachkräften für die Energiewende, also z. B. den Ausbau von Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen, um circa 170 Prozent gestiegen.
Nachfrage nach Fachkräften für Energiewende steigt
Die Nachfrage nach Fachkräften steigt kontinuierlich an, ähnlich wie in vielen anderen Branchen in Deutschland. Insgesamt ist die Nachfrage von August 2020 bis August 2023 um 168 Prozent gestiegen. Der vergleichsweise geringste Anstieg zum Vorjahreszeitraum wurde zwischen August 2020 und August 2021 verzeichnet und betrug etwa 16,8 Prozent. Der Anstieg von August 2021 bis August 2022 war mit rund 75,6 Prozent deutlich höher. In der Zeitspanne von August 2022 bis August 2023 zeigt sich kaum Entspannung: Der Personalbedarf stieg weiter um 30,8 Prozent.
Hier sehen Sie im Überblick, wie sich die Jobnachfrage entwickelt hat:
Im Sommer 2023 herrscht großer Personalbedarf für Energiewende
Im August 2023 wurden auf der Jobplattform Indeed pro eine Million Anzeigen etwa 13.550 neue Stellenanzeigen für verschiedene Positionen in der Wärmepumpen- und Solarbranche veröffentlicht. Die Monate Juli 2023 mit 13.182 und Juni 2023 mit 12.972 Anzeigen folgen auf den Plätzen zwei und drei. Die Suche nach Fachkräften in diesem Bereich war 2020 geringer: Mit nur 5.050 Anzeigen pro eine Million Stellenanzeigen belegt der August 2020 den letzten Platz, gefolgt von September 2020 und Oktober 2020 mit jeweils 5.229 und 5.288 Anzeigen.
Den genauen zeitlichen Verlauf zeigt dieses Diagramm:
Handwerkliches Talent gesucht: Installateur:innen begehrt wie nie zuvor
10,72 Prozent der untersuchten Stellenanzeigen seit 2020 richteten sich an Fachkräfte für den Einbau von unter anderem Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Direkt danach folgt die Nachfrage nach Lagerist:innen mit 6,86 Prozent. Auch in der Produktion ist dringend Personal gefragt, mit 6,79 Prozent aller ausgeschriebenen Stellen.
Was haben wir untersucht?
Enpal untersuchte in einer Kooperation mit der Jobplattform Indeed die Anzahl sowie Art der Stellenausschreibungen auf der Jobplattform, welche eines oder mehrere der folgenden Keywords enthielten: Solaranlage, Solaranlagen, Photovoltaik, Pv, Wärmepumpe, Wärmepumpen, Energiewende, Solarteur, Photovoltaikanlagen, Erneuerbare Energien, Erneuerbare Energie, Fotovoltaik. Berücksichtigt wurden Ausschreibungen seit August 2020.
Online-Interesse an Wärmepumpen
Klimawandel, Konflikt in der Ukraine und staatliche Förderung: Diese Veränderungen prägen nicht nur die Weltbühne, sondern auch die Entwicklung rund um das Thema Energieversorgung hierzulande. Wir haben die vergangenen vier ereignisreichen Jahre betrachtet und untersucht, wie sich das Interesse der deutschen Bevölkerung an Wärmepumpen entwickelt hat. Hierfür haben wir analysiert, wie häufig bestimmte Suchbegriffe im Zusammenhang mit Wärmepumpen bei Google gesucht wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass das Interesse im März 2023 und März 2022 besonders stark angestiegen ist – jeweils um fast 200 Prozent. Insgesamt verzeichnete das Interesse an Wärmepumpen während des untersuchten Zeitraums durchschnittlich einen Anstieg von etwa 13 Prozent.
Vielfältiges Interesse: Einbauanfragen bei Wärmepumpen relevant
Bei der Betrachtung der durchschnittlichen jährlichen Veränderung der Suchanfragen zeigt sich, dass das Interesse am Einbau einer Wärmepumpe am stärksten gestiegen ist. Suchanfragen zu Keywords wie „wärmepumpe installateur”“ oder „wärmepumpe anbieter“ hier im Schnitt zu. Auf Platz zwei landen Keywords zum Thema der Kosten von Wärmepumpen. Hier nahmen die Suchanfragen bei Keywords wie „wärmepumpe kosten“ oder „was kostet eine wärmepumpe“ immerhin um etwa 13 Prozent zu. Platz drei geht an generelle Suchanfragen zu Wärmepumpen, hier stieg das Interesse um etwa neun Prozentpunkte bei Suchbegriffen wie „wärmepumpe“ und „wie funktioniert eine wärmepumpe“. Betrachtet man alle Keywords, beläuft sich der gesamte Anstieg des Suchvolumens auf etwa 13 Prozent.
Wie sich das Interesse nach Wärmepumpen seit 2020 entwickelt hat, sehen Sie hier:
Sprunghafter Anstieg: März 2022 und 2023 dominieren das Interesse an Wärmepumpen
Im März 2023 verzeichnete die Untersuchung den größten Anstieg des Interesses im Vergleich zum Vormonat: Bei allgemeinen Suchanfragen zu Wärmepumpen stieg das Interesse um beeindruckende 196 Prozent. Ebenfalls im März 2023 auf dem zweiten Platz liegen Suchanfragen zum Einbau von Wärmepumpen, die um etwa 184 Prozent zunahmen. Der März 2022 war ebenfalls ein herausragender Monat für Wärmepumpen, da das Interesse um etwa 167 Prozent stieg, was den dritten Platz in diesem Ranking einnimmt. Die vierten und fünften Plätze gehen ebenfalls an März 2022 und März 2023, wobei Suchanfragen zu den Kosten einer Wärmepumpe jeweils um 159 bzw. 148 Prozent häufiger gesucht wurden.
Wie sich das Interesse von Monat zu Monat nach Wärmepumpen generell, der Einbau und die Kosten verändert hat, sehen Sie hier:
Was haben wir untersucht?
Für die Untersuchung wurden insgesamt 46 Keywords auf ihr Suchvolumen von März 2020 bis Februar 2024 untersucht. Die Keywords wurden anschließend thematisch gruppiert und der Durchschnitt der einzelnen Keywords als Wert für die Gruppe berechnet. Gruppen sind: Wärmepumpe Einbau, Wärmepumpe Generell, Wärmepumpe Kosten.