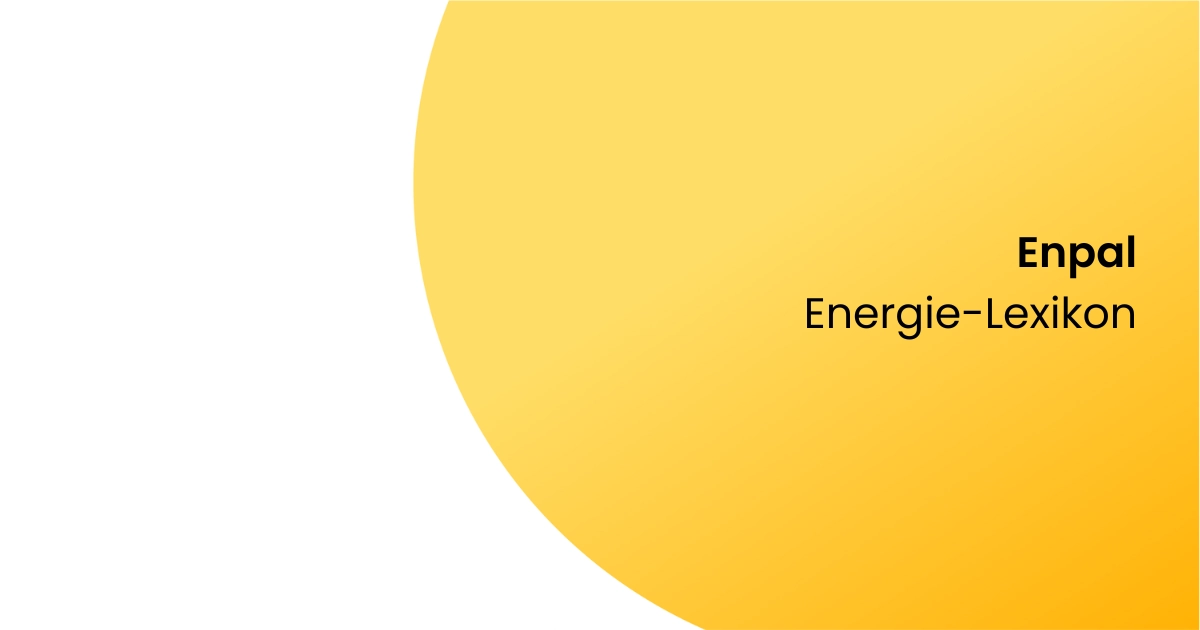
Die Stromumlage ist ein gesetzlich geregelter Aufschlag auf den Strompreis. Sie deckt bestimmte Kosten im Energiesystem ab, zum Beispiel für die Förderung erneuerbarer Energien oder für den Netzbetrieb. Wer Strom aus dem öffentlichen Netz bezieht, zahlt automatisch die jeweils gültigen Umlagen mit.
Mehr Erneuerbare, neue Verbraucher wie Wärmepumpen, Einspeisung aus PV und Wind: Das Stromsystem in Deutschland verändert sich. Um diese Transformation zu finanzieren, gibt es verschiedene Umlagen. Sie sorgen dafür, dass bestimmte Aufgaben – wie der Ausbau der Netze oder die Integration von Grünstrom – gemeinschaftlich getragen werden.
Ein Beispiel: Die EEG-Umlage, die bis 2022 gültig war, diente dazu, Betreiber von PV- oder Windanlagen für ihren eingespeisten Strom zu vergüten – unabhängig vom Börsenpreis. So konnte der Ausbau der Erneuerbaren finanziert werden.
Die Abschaffung der EEG-Umlage hat die Umlagenstruktur im Strompreis verschlankt, aber nicht beendet. Stromkunden zahlen weiterhin mehrere gesetzlich geregelte Umlagen:
Bis Ende 2023 wurde auch eine Umlage für abschaltbare Lasten (§ 18 AbLaV) erhoben. Sie diente dazu, industrielle Großverbraucher zu vergüten, die auf Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber kurzfristig ihren Stromverbrauch reduzieren konnten. Die daraus entstehenden Kosten wurden über eine Umlage auf alle Letztverbraucher verteilt. Diese Regelung ist jedoch gemäß § 20 Abs. 2 AbLaV zum 31.12.2023 vollständig außer Kraft getreten.
Wer Strom aus der eigenen PV-Anlage nutzt, zahlt auf diesen Eigenverbrauch in der Regel keine Stromumlagen – jedenfalls nicht in Einfamilienhäusern mit einer installierten Leistung unter 30 kWp. Damit lohnt sich der Eigenverbrauch doppelt: Er reduziert den Netzbezug und spart Umlagen.
Anders sieht es aus, wenn der Strom verkauft oder innerhalb eines Gebäudes verteilt wird, zum Beispiel bei Mieterstrommodellen. Dann gelten spezielle Regelungen. Auch die Strommengenmessung muss stimmen, damit Netzbetreiber und Abrechnungssysteme die richtigen Umlagen berechnen können. Smart Meter schaffen hier Transparenz.
Wärmepumpen gelten als steuerbare Verbrauchseinrichtungen. Haushalte mit einer steuerbaren Wärmepumpe können unter bestimmten Voraussetzungen reduzierte Netzentgelte oder Tarife mit geringeren Umlageanteilen erhalten, etwa nach § 14a EnWG. Die Voraussetzung: Der Netzbetreiber darf die Leistung der Wärmepumpe bei Bedarf drosseln.
Zusätzlich macht der hohe Stromverbrauch von Wärmepumpen Unterschiede bei der Umlagenbelastung spürbar. Je mehr Strom aus dem Netz bezogen wird, desto größer die Rolle der Umlagen im Gesamtpreis – es sei denn, ein Teil des Bedarfs wird mit Solarstrom gedeckt. Mehr dazu hier: Wärmepumpe mit Photovoltaik
Stromumlagen machen heute rund ein Zehntel des Endkundenpreises aus. Die genaue Höhe schwankt, abhängig vom Netzgebiet, Stromverbrauch und Tarifmodell. Kritiker sehen vor allem bei der Industrieausnahme (§ 19 StromNEV) eine ungerechte Verteilung: Haushalte und kleine Gewerbe zahlen mehr, damit energieintensive Betriebe entlastet werden.
Trotzdem sind Umlagen wichtig: Sie finanzieren die Energiewende, machen den Strommarkt steuerbar und schaffen Anreize für flexiblen Verbrauch. Wer mit PV-Strom Eigenverbrauch deckt oder Strom intelligent nutzt, kann Umlagen reduzieren – und den Wandel aktiv mitgestalten.