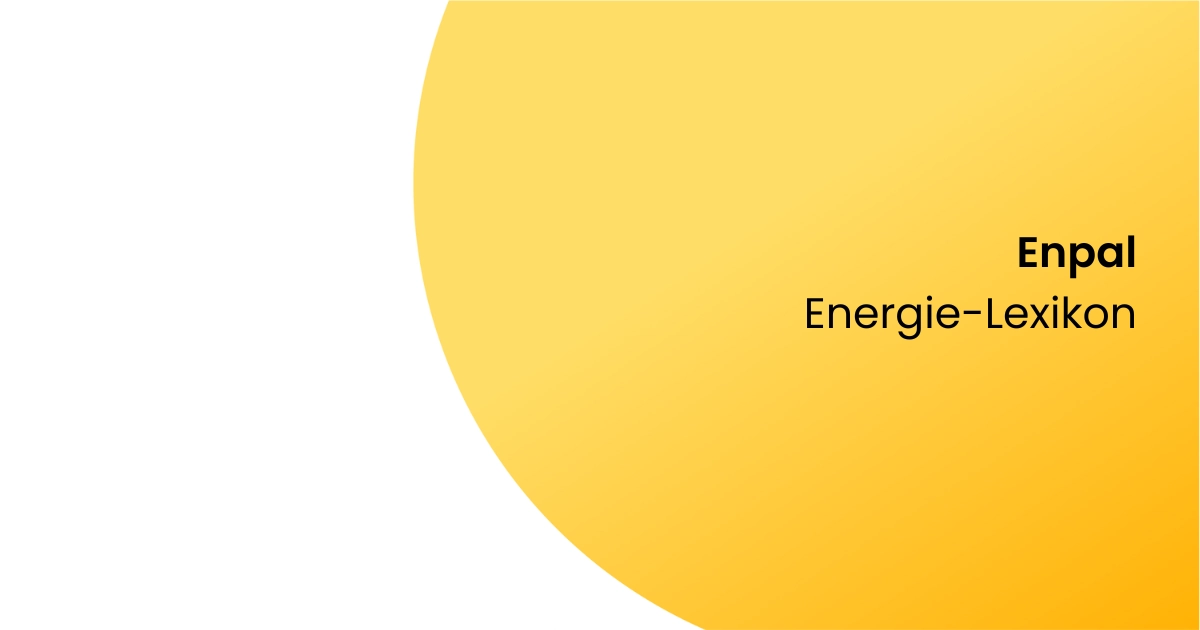
Ein Redispatch ist die gezielte Umverteilung von Einspeisungen im Stromnetz. Netzbetreiber greifen dabei aktiv in die Fahrpläne von Kraftwerken oder Erzeugungsanlagen ein, um eine Überlastung einzelner Leitungen zu vermeiden. Die Gesamtmenge an Strom bleibt gleich, aber der Ort der Einspeisung wird verändert. So bleibt das Netz auch bei hoher Auslastung stabil.
Die Grundlage für Redispatch sind sogenannte Lastflussberechnungen. Netzbetreiber nutzen die gemeldeten Einspeisepläne (Dispatch), um vorherzusagen, welche Netzabschnitte am nächsten Tag stark belastet sein werden. Droht eine Überlastung, greifen sie steuernd ein: Anlagen diesseits des Engpasses reduzieren ihre Einspeisung, während andere jenseits ihre Leistung erhöhen. Der Stromfluss wird so gezielt umgelenkt.
Ein Redispatch läuft in mehreren Schritten ab:
Die gesetzliche Grundlage für diese Eingriffe bildet § 13 EnWG. Auch Blindleistung kann beim Redispatch eingesetzt werden. Sie hilft, die Spannung im Netz zu stabilisieren, ohne nutzbare Energie bereitzustellen.
Am 1. Oktober 2021 ist der neue Redispatch in Kraft getreten. Der sogenannte „Redispatch 2.0“ bezieht nicht nur große Kraftwerke ein, sondern auch dezentrale Erzeugungsanlagen mit mehr als 100 kW installierter Leistung – darunter viele Photovoltaikanlagen. Voraussetzung: Die Anlage ist steuerbar und wird direkt vermarktet. Geregelt ist das Verfahren unter anderem im novellierten Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG).
Neu ist vor allem die einheitliche Datenbasis: Alle relevanten Anlagen melden ihre geplante Einspeisung, damit der Redispatch über Netzgrenzen hinweg koordiniert werden kann. So sollen weniger Strommengen verloren gehen und Engpässe effizienter behoben werden.
Im klassischen Einspeisemanagement haben Netzbetreiber PV- oder Windanlagen bei drohenden Engpässen einfach abgeregelt. Diese Praxis wurde 2021 abgelöst. Beim Redispatch 2.0 geht es nicht mehr um das Reduzieren der Gesamtmenge, sondern um das gezielte Verschieben der Einspeisung. Damit bleibt mehr Strom im Netz verfügbar – und die Versorgungssicherheit steigt.
Der steigende Anteil erneuerbarer Energien verändert die Stromflüsse im Netz. Große PV- und Windparks stehen oft nicht dort, wo der Strom verbraucht wird. Wenn zum Beispiel im Norden viel Windstrom erzeugt wird, die Leitungen in den Süden aber ausgelastet sind, entstehen Engpässe. Wärmepumpen und Batteriespeicher können dabei helfen, die erzeugte Energie vor Ort zu nutzen, reichen aber nicht immer aus. Der Redispatch hilft in solchen Situationen, das Gleichgewicht zu sichern.
Die Bundesregierung berichtet, dass Redispatch-Eingriffe in den letzten Jahren stark zugenommen haben. Der Grund: Der Netzausbau hält oft nicht mit dem Ausbau der Erneuerbaren mit. Bis die Netze flächendeckend modernisiert sind, bleibt der Redispatch ein unverzichtbares Werkzeug für die Netzstabilität.
Große Photovoltaikanlagen, die steuerbar sind und in die Direktvermarktung fallen, müssen sich am Redispatch beteiligen. An besonders sonnigen Tagen kann es vorkommen, dass der Netzbetreiber ihre Leistung temporär reduziert – zum Beispiel, wenn eine Leitung überlastet ist. Die Betreiber erhalten für diese Ausfallarbeit eine finanzielle Entschädigung, damit sie wirtschaftlich nicht benachteiligt werden. Der gesetzliche Einspeisevorrang für erneuerbare Energien bleibt grundsätzlich bestehen – allerdings mit Ausnahmen im Redispatch-Verfahren. Laut Bundesnetzagentur darf konventionelle Erzeugung nicht bevorzugt behandelt werden.
Wärmepumpen verbrauchen Strom und sind deshalb Teil der Lösung. Über intelligente Steuerung lassen sie sich so betreiben, dass sie vor allem dann laufen, wenn viel Strom verfügbar ist. Zum Beispiel mittags bei hoher PV-Erzeugung. Das hilft, Lastspitzen im Netz zu vermeiden und erzeugte Energie direkt vor Ort zu nutzen. Seit 2024 vereinfacht § 14a EnWG den steuerbaren Betrieb.