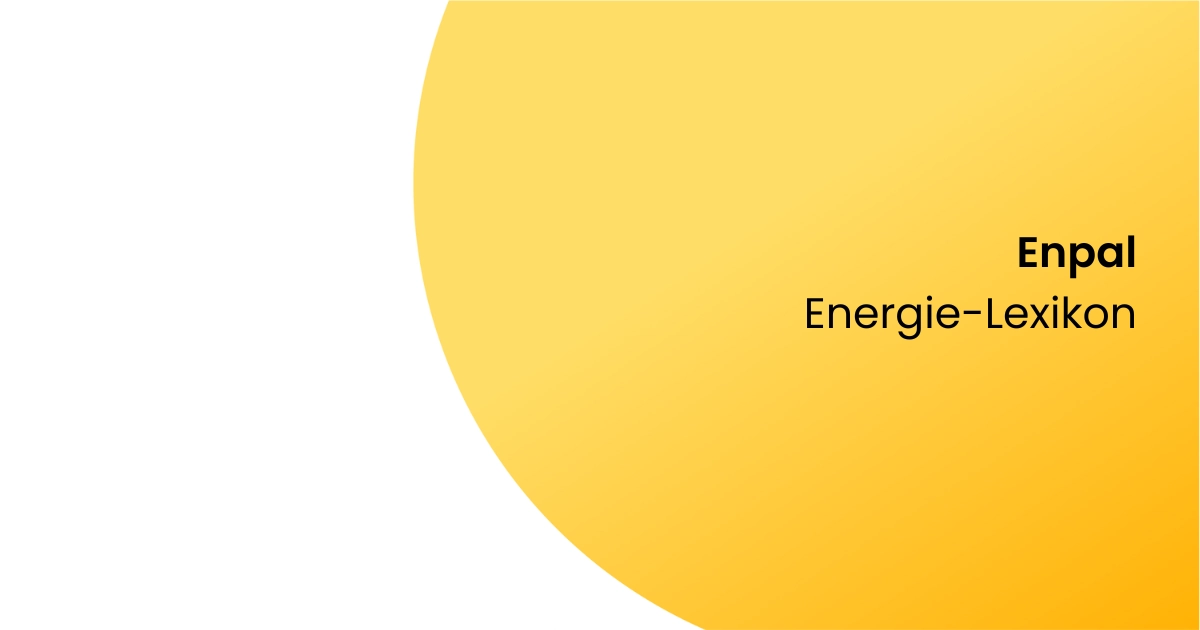
Hochverfügbarkeit ist die Fähigkeit technischer Systeme, dauerhaft und unterbrechungsfrei zu funktionieren – auch wenn einzelne Komponenten ausfallen. Im Stromnetz bedeutet das: Strom fließt auch dann stabil, wenn irgendwo ein Fehler auftritt – sei es in einem Umspannwerk, in der Steuerungstechnik oder bei einem Netzknoten.
Damit das gelingt, müssen Stromnetze, digitale Steuerungssysteme und virtuelle Kraftwerke rund um die Uhr einsatzfähig sein. Das gilt besonders dann, wenn viele Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und andere flexible Verbraucher mit dem Netz verbunden sind.
Die Verfügbarkeit eines Systems beschreibt, wie wahrscheinlich es ist, dass es in einem bestimmten Zeitraum funktioniert. Ein Wert von 99 % bedeutet zum Beispiel: Das System darf bis zu 87 Stunden im Jahr ausfallen. Von Hochverfügbarkeit ist erst ab einer Quote von 99,9 % die Rede – das entspricht rund neun Stunden Ausfall pro Jahr. Besonders zuverlässige Systeme erreichen sogar 99,999 % und dürfen damit nur etwa fünf Minuten pro Jahr nicht verfügbar sein.
Solche Zahlen finden sich unter anderem in den Verfügbarkeitsklassen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Je höher die Klasse, desto geringer die erlaubte Ausfallzeit. Systeme mit dieser Leistung arbeiten meist mit mehrfacher technischer Absicherung und umfassender IT-Überwachung.
Robuste Komponenten allein reichen nicht aus. Damit ein System hochverfügbar ist, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Besonders wichtig ist, dass wichtiger Bauteile wie Netzteile, Steuerungen oder Datenleitungen mehrfach vorhanden sind. Denn wenn ein Teil ausfällt, muss sofort ein anderes übernehmen. Gleichzeitig müssen die Systeme fehlertolerant sein: Sie müssen automatisch auf Probleme reagieren, ohne dass jemand händisch eingreift. Wird das System kontinuierliche überwacht, lassen sich Störungen früh erkennen.
Diese Prinzipien finden sich auch im Energiesektor wieder. Netzleitstellen greifen zum Beispiel bei Störungen automatisch ein, steuern Erzeuger und Verbraucher nach Bedarf und gleichen Schwankungen in Echtzeit aus. Welche Rolle spielt IT-Sicherheit?
Doch Hochverfügbarkeit hängt nicht nur von Technik, sondern auch von Cybersicherheit ab. So setzen Netzbetreiber auf Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS) nach ISO/IEC-Standards. Gemeinsam mit der Bundesnetzagentur hat das BSI Sicherheitskataloge entwickelt, die kritische Infrastrukturen schützen. Ziel ist es, Stromnetze auch gegen Cyberangriffe und Manipulationen abzusichern.
Netzbetreiber müssen dafür spezielle Ansprechpartner benennen, ihre Systeme zertifizieren lassen und auf widerstandsfähige Software- und Hardwarelösungen setzen. So bleibt das Netz nicht nur technisch stabil, sondern auch digital geschützt.
Die Stromversorgung wird dezentraler, dynamischer und digitaler. PV-Anlagen erzeugen Strom wetterabhängig, Wärmepumpen reagieren flexibel auf Netzzustände, smarte Haushaltsgeräte kommunizieren mit dem Netz. Damit all das reibungslos funktioniert, braucht es eine Infrastruktur, die nahezu durchgehend verfügbar ist – im Sekundentakt, jeden Tag.
Hochverfügbarkeit ist deshalb kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung für ein klimafreundliches, stabiles Stromsystem. Sie sorgt dafür, dass Netzfrequenz und Spannung im Netz gehalten werden – auch wenn Sonne, Wind und Verbrauch sich ständig ändern. Nur mit hochverfügbaren Systemen lassen sich Stromausfälle vermeiden und moderne Technologien im Alltag zuverlässig nutzen.