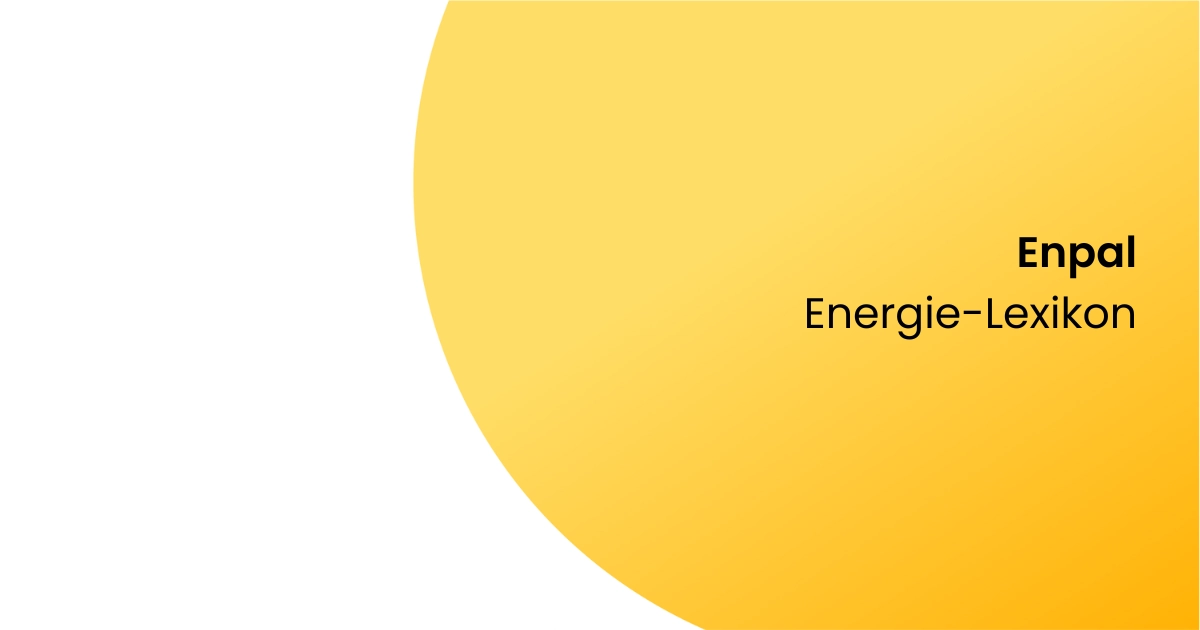
Strom ist Energie in Bewegung. Genauer gesagt: Strom entsteht, wenn sich elektrisch geladene Teilchen, meist Elektronen, durch ein leitfähiges Material wie Kupfer bewegen. Diese Bewegung erzeugt elektrische Energie, mit der sich Geräte betreiben, Licht erzeugen oder Wärme bereitstellen lässt.
Im Alltag treibt Strom fast alles an: Lichtquellen, Kühlschränke, Fernseher, Ladegeräte oder Waschmaschinen. Auch moderne Heizungen wie z. B. Wärmepumpen nutzen Strom, um Wärme aus der Umgebung für das Heizen nutzbar zu machen.
Die Geschichte des elektrischen Stroms beginnt mit ersten naturwissenschaftlichen Entdeckungen im 18. Jahrhundert. Im Jahr 1800 entwickelte Alessandro Volta die erste funktionierende Batterie. Wenige Jahrzehnte später erforschten James Clerk Maxwell und Michael Faraday die Grundlagen elektromagnetischer Felder und legten damit den Grundstein für die Erfindung von Generatoren und Elektromotoren.
Die erste elektrische Straßenbeleuchtung Deutschlands ging 1884 in Berlin in Betrieb. Ab Anfang des 20. Jahrhunderts setzte sich Strom nach und nach im Alltag durch. Es entstanden große Stromnetze, zentrale Kraftwerke und später auch dezentrale Lösungen wie Photovoltaikanlagen.
Heute ist Strom nicht mehr wegzudenken. Weil immer mehr Autos, Heizungen und Maschinen mit Strom statt mit Öl oder Gas betrieben werden, steigt der Bedarf. Gleichzeitig muss der Strom klimafreundlich und zuverlässig bereitstehen.
Strom kann auf verschiedenen Wegen entstehen:
In allen Fällen wird mechanische Energie genutzt, um Generatoren anzutreiben, die daraus Strom erzeugen. Der produzierte Strom gelangt dann über verschiedene Spannungsebenen ins öffentliche Stromnetz.
Zuerst fließt er mit sehr hoher Spannung durchs Höchstspannungsnetz, mit bis zu 380.000 Volt über weite Strecken. Für Haushalte wird er später in der Niederspannungsebene in mehreren Schritten auf 230 Volt heruntergeregelt, bevor er in die Steckdose gelangt.
Nach der Erzeugung wird Strom über das Übertragungsnetz in die Regionen geleitet und über das Verteilnetz an Haushalte und Betriebe verteilt. Dabei durchläuft er mehrere technische Ebenen:
Netzbetreiber achten darauf, dass immer genug Strom da ist – auch bei stark schwankendem Verbrauch. Dafür setzen sie unter anderem sogenannte Regelenergie ein, also Strommengen, die bei Bedarf kurzfristig ins Netz eingespeist werden.
In vielen Eigenheimen kommt ein Teil des Stroms heute direkt vom Dach, zum Beispiel mit einer Solaranlage. Wer den Solarstrom speichert, kann ihn auch abends oder bei schlechtem Wetter nutzen. Reicht er nicht aus, springt automatisch das öffentliche Netz ein.
Elektrischer Strom entsteht, wenn sich Elektronen durch einen Leiter bewegen. Damit Strom fließen kann, braucht es eine Spannungsquelle – etwa eine Batterie oder ein Kraftwerk –, die den Stromfluss antreibt.
Die Einheit für elektrische Energie ist die Kilowattstunde (kWh). Sie gibt an, wie viel Strom ein Gerät in einer Stunde verbraucht oder erzeugt.
Eine Kilowattstunde entspricht dem Verbrauch von 1.000 Watt über einen Zeitraum von einer Stunde.
Ein einfaches Beispiel: Eine Herdplatte mit 1.000 Watt Leistung verbraucht in einer Stunde eine Kilowattstunde Strom.
Wie wird Strom im Haushalt gemessen?
Der Stromzähler im Haushalt misst, wie viel Strom in Kilowattstunden verbraucht wird. Der Strompreis wird entsprechend pro Kilowattstunde berechnet und setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen:
Intelligente Stromzähler, sogenannte Smart Meter, zeigen zusätzlich an, wann wie viel Strom verbraucht oder ins Netz eingespeist wird. Besonders praktisch ist das bei einem Energiesystem mit PV-Anlage, Speicher und Wärmepumpe. So lässt sich der selbst erzeugte Strom möglichst effizient nutzen.
In der Elektrotechnik beschreibt das sogenannte Ohmsche Gesetz den Zusammenhang zwischen Spannung, Stromstärke und Widerstand. Es lautet:
Stromstärke = Spannung geteilt durch elektrischen Widerstand.
Oder anders formuliert: Je höher die Spannung ist und je weniger ein Material den Strom abbremst, desto mehr Strom kann fließen. Der Widerstand gibt also an, wie stark sich ein Material dem Stromfluss entgegenstellt. Dicke und kurze Kabel leiten Strom besser als dünne und lange.
Die Formel dazu ist:
I = U / R,
Die Energiewende setzt auf Strom aus erneuerbaren Quellen, vor allem aus Wind und Sonne. Und der Anteil von Ökostrom im Netz wächst stetig und ersetzt zunehmend Strom aus fossilen Energiequellen, zum Beispiel in den Bereichen
Strom kommt dabei nicht mehr nur aus großen Kraftwerken. Immer häufiger wird er direkt vor Ort erzeugt, etwa mit Solaranlagen auf dem eigenen Dach.