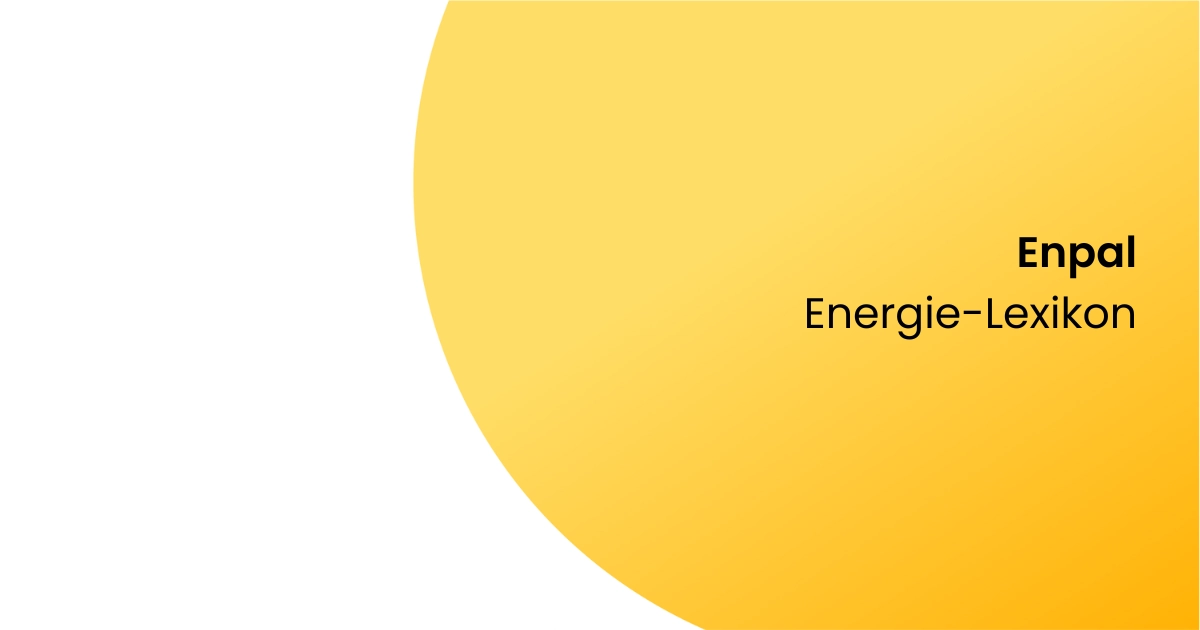
Ein Schwarzstart ist der Neustart des Stromnetzes nach einem großflächigen Stromausfall. Nur bestimmte Kraftwerke oder Stromspeicher können in einem solchen Fall selbstständig Strom erzeugen, um das Netz schrittweise wieder aufzubauen.
Diese Anlagen nennt man „schwarzstartfähig“. Sie arbeiten gewissermaßen wie eine Starterbatterie: Mit ihrer Hilfe lassen sich andere Kraftwerke hochfahren, die regulär Strom ins Netz einspeisen.
Wenn das Netz ausfällt, lautet das oberste Ziel der Übertragungsnetzbetreiber: Das Stromnetz schrittweise, kontrolliert und sicher wieder hochfahren.
Dafür bringen sie zuerst mithilfe einer schwarzstartfähigen Anlage, ein erstes Teilnetz im sogenannten „Inselbetrieb“ wieder unter Spannung. Das kann zum Beispiel mit einem ein Pumpspeicherkraftwerk, eine Gasturbine oder einem Batteriespeicher geschehen.
Sobald die Frequenz stabil ist, synchronisieren die Netzbetreiber das Teilnetz mit dem restlichen Stromnetz und schalten weitere Verbraucher, Kraftwerke und Leitungen gezielt zu. So kehrt Stück für Stück wieder Spannung ein, immer mit Blick auf die Netzfrequenz und die richtige Leistung.
Bei Bedarf beziehen sie zusätzlich Wirk- und Blindleistung aus benachbarten Netzregionen, um den Spannungshaushalt zu stabilisieren.
Damit ein Schwarzstart funktioniert, muss eine Anlage eigenständig anlaufen können – ohne Strom von außen. Dazu muss sie robust gebaut sein, schnell reagieren und im Inselbetrieb arbeiten können. Schwarzstartfähige Anlagen sind unter anderem:
Große thermische Kraftwerke – wie Kohle-, Atom- oder auch viele Biomasseanlagen – können nicht allein starten. Sie müssen erst mit Strom versorgt werden, bevor sie selbst Energie einspeisen.
Früher liefen Schwarzstarts vor allem über Wasserkraft oder Gasturbinen. Heute kommen Batteriespeicher dazu – und das aus gutem Grund. Denn sie funktionieren ortsunabhängig, reagieren sofort und liefern Strom auf Abruf. In mehreren Pilotprojekten, etwa in Schwerin, haben Batteriekraftwerke bereits erfolgreich Teilnetze versorgt und den Start konventioneller Kraftwerke unterstützt.
Auch gespeicherter Solar- und Windstrom lässt sich so nutzen. In Kombination mit PV-Anlage und Heimspeicher entsteht ein System, das zur Eigenversorgung beiträgt und im Notfall sogar das Netz wiederbeleben kann. Man kann dabei von einem virtuellen Kraftwerk sprechen.
Die vier Übertragungsnetzbetreiber schreiben regelmäßig schwarzstartfähige Leistung aus. Das passiert in einem marktgestützten Verfahren, das die Bundesnetzagentur festgelegt hat.
Grundlage sind § 12h EnWG und die EU-Verordnung 2017/2196 („Network Code Emergency and Restoration“). Anbieter müssen nachweisen, dass ihre Anlagen technische und organisatorische Anforderungen erfüllen. Dazu gehören beispielsweise Spannung aufbauen, Netzfrequenz regeln und stabil im Inselbetrieb laufen können.
Die Ausschreibungen erfolgen regional gestaffelt und mit mehreren Jahren Vorlaufzeit. So haben auch neue oder nachgerüstete Anlagen eine Chance auf den Zuschlag.