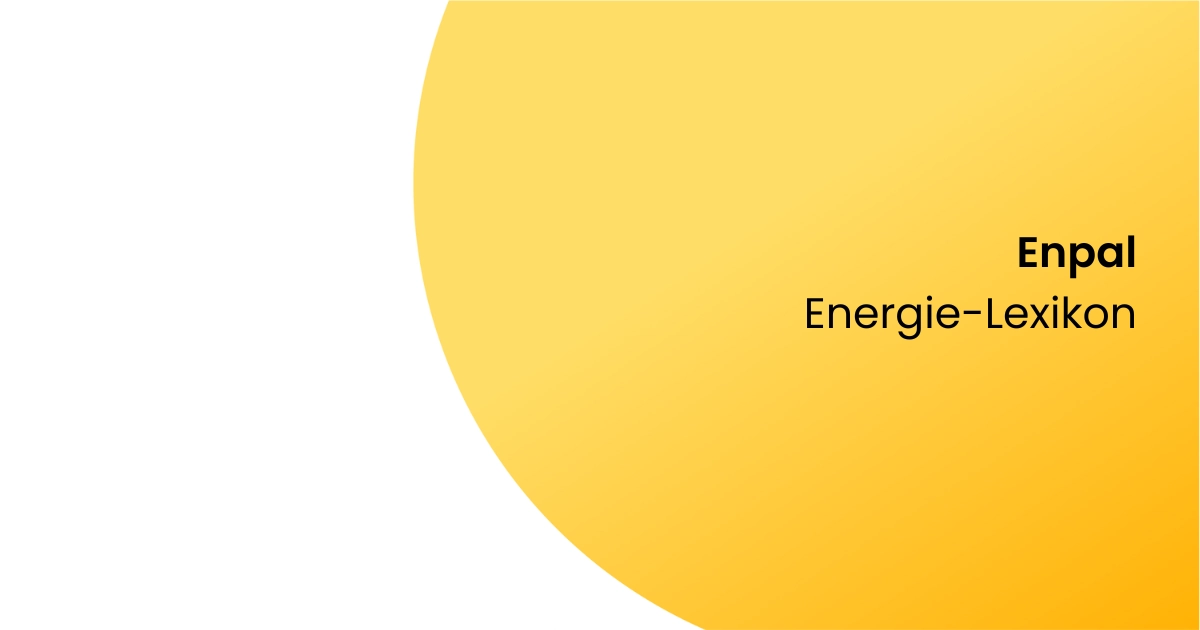
Die Niederspannung ist die Spannungsebene, durch die die meisten Alltagsgeräte mit Strom versorgt werden. Sie versorgt zum Beispiel Haushalte, kleinere Betriebe, Wärmepumpen und Wallboxen mit Strom. Gemeint sind Spannungen bis 1.000 Volt (Wechselstrom) oder 1.500 Volt (Gleichstrom). In der Praxis bedeutet das: 230 Volt zwischen Phase und Neutralleiter – oder 400 Volt zwischen zwei Phasen, etwa beim Anschluss von Starkstromgeräten wie Herd, Wärmepumpe oder Wallbox.
Im Stromnetz ist die Niederspannung die unterste Netzebene. Bevor Strom an der Steckdose ankommt, legt er einen weiten Weg zurück – von der Höchstspannung über Hochspannung und Mittelspannung bis zur lokalen Trafostation. Dort wird er auf das passende Niveau transformiert und über das Niederspannungsnetz weitergeleitet. Diese Struktur der Spannungsebenen sorgt dafür, dass Strom effizient transportiert und vor Ort sicher verteilt werden kann.
Das Niederspannungsnetz ist das Rückgrat für den Stromverbrauch im direkten Umfeld. In Städten verlaufen die Leitungen in der Regel unterirdisch als Erdkabel, auf dem Land gibt es noch vereinzelt Freileitungen. Gerade weil auf dieser Ebene besonders viele Geräte gleichzeitig aktiv sind, wird das Netz stark beansprucht – noch mehr, wenn zusätzlich Strom eingespeist wird, etwa aus Solaranlagen.
Typisch für die Niederspannung ist die direkte Einspeisung kleiner PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern. Der erzeugte Gleichstrom wird im Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt und anschließend direkt genutzt, im Speicher zwischengelagert oder ins Netz eingespeist. Auch Wärmepumpen, Ladeeinrichtungen für E-Autos und smarte Haushaltsgeräte nutzen diese Spannungsebene. Die wichtigsten technischen Vorgaben für Planung und Betrieb legt die Norm VDE-AR-N 4105 fest – von der Netzintegration über Schutzmaßnahmen bis zur Kommunikation der Geräte.
Besonders relevant wird die Niederspannung, wenn viele Anwendungen gleichzeitig betrieben werden – etwa eine PV-Anlage mit Speicher, eine Wärmepumpe und ein E-Auto. Dann stellt sich die Frage, ob der bestehende Netzanschluss ausreicht. Bei hoher Leistungsaufnahme kann eine Verstärkung des Anschlusses nötig sein, in manchen Fällen auch ein zweiter Anschluss oder ein Energiemanagementsystem, das die Lasten automatisch steuert.
Anders als Hochspannung oder Mittelspannung war das Niederspannungsnetz früher auf passive Verbraucher ausgelegt. Heute aber wird es durch die Energiewende zu einem komplexen Knotenpunkt für Erzeugung, Speicherung und Verbrauch. Deshalb braucht es ein intelligentes Netzmanagement – Stichwort Smart Grid. Batteriespeicher laden bei PV-Überschuss, Wärmepumpen nutzen windreiche Stunden, und E-Autos laden nachts oder wenn das Netz wenig ausgelastet ist.
Seit 2024 dürfen Netzbetreiber steuerbare Verbraucher wie Wärmepumpen oder Wallboxen temporär drosseln, um das Netz zu entlasten. Im Gegenzug profitieren Betreiber von reduzierten Netzentgelten. Die Steuerung erfolgt automatisiert und beeinträchtigt den Komfort nicht – etwa weil das Auto trotzdem über Nacht vollgeladen wird. Mehr dazu hier: § 14a EnWG
Studien zeigen: Wird die Niederspannungsebene durch Digitalisierung und flexible Steuerung gezielt optimiert, lassen sich Netzengpässe vermeiden, mehr PV-Strom vor Ort nutzen und Haushalte entlasten. Voraussetzung ist, dass die eingesetzten Geräte – etwa Speicher, Wechselrichter und Wärmepumpen – miteinander kommunizieren können.
Niederspannung ist also mehr als der „Strom aus der Steckdose“. Als Basis für den dezentralen Ausbau von Solaranlagen, Speichern, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur kommt ihr eine Schlüsselrolle zu. Sie ist ein zentrales Element der Energiewende – im Zusammenspiel mit Hochspannung, Mittelspannung, den übergeordneten Spannungsebenen und der allgemeinen Netzebene.