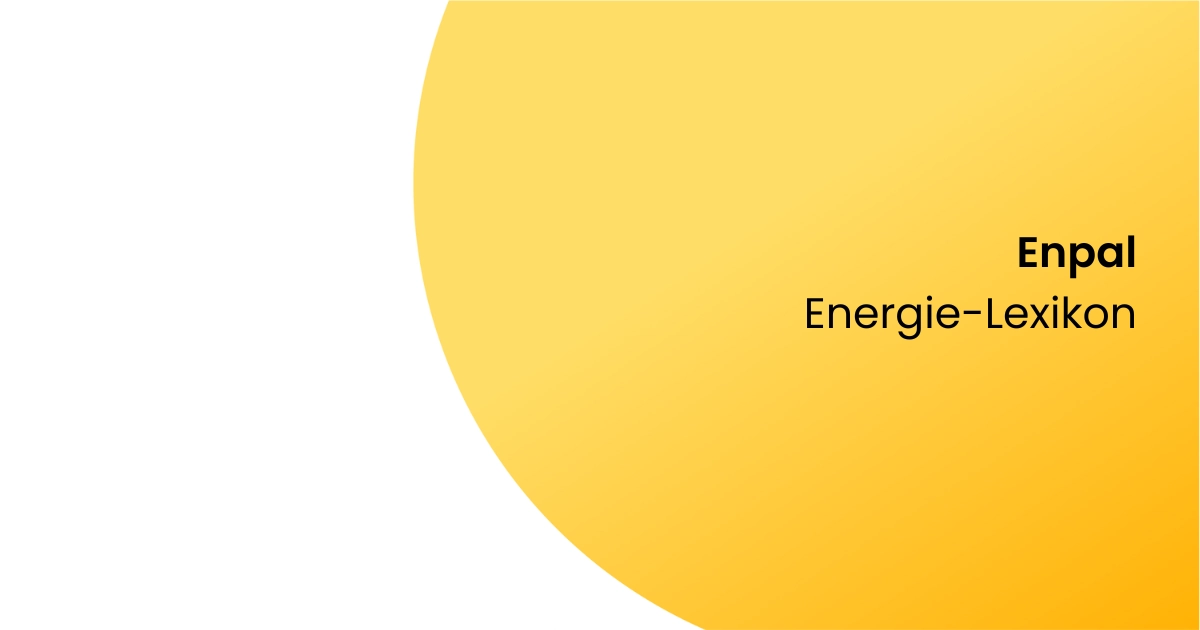
Eine Marktlokation ist ein eindeutig definierter Punkt im Stromnetz, an dem Energie verbraucht oder eingespeist wird – zum Beispiel ein Wohnhaus, eine PV-Anlage oder eine Wärmepumpe. Sie ist die Grundlage für alles, was mit Abrechnung, Stromlieferung und Netzanschluss zu tun hat, zum Beispiel Lieferverträge, Abrechnungen, Netzanschlüsse und Bilanzierungen.
Ohne klar definierte Marktlokation wäre ein sicherer Betrieb des Stromnetzes kaum möglich. Denn Stromversorger, Netzbetreiber und Messstellenbetreiber müssen exakt wissen, wo Strom verbraucht oder eingespeist wird – und wer dafür verantwortlich ist. Die Marktlokation sorgt dafür, dass alle Energieflüsse – ob Verbrauch oder Einspeisung – korrekt zugeordnet und abgerechnet werden können.
Früher gab es viele Begriffe wie „Zählpunkt“, „Lieferstelle“ oder „Messstelle“, die oft durcheinander genutzt wurden. Mit der Einführung der Marktlokation im Jahr 2018 durch die Bundesnetzagentur wurde eine klare Trennung geschaffen – vor allem, um die Abrechnung und die Marktkommunikation zu vereinfachen.
Die Marktlokation beschreibt den Punkt im Stromnetz, an dem Energie einem Haushalt oder Unternehmen zugeordnet wird. Dabei bildet sie den kaufmännischen Teil ab: Sie ist der Ort, dem Lieferungen und Einspeisungen zugeordnet werden – für Stromtarife, Wechselprozesse, Abrechnungen und die Marktkommunikation zwischen Netzbetreibern und Lieferanten. Die Messlokation dagegen ist der Ort, an dem tatsächlich gemessen wird – also der Zähler.
Ein Beispiel: In einem Haus mit Einliegerwohnung gibt es zwei Zähler – einen für die Hauptwohnung, einen für die Einliegerwohnung. Das sind zwei Messlokationen. Wenn aber beide Wohnungen gemeinsam abgerechnet werden, gibt es nur eine Marktlokation. Alle Zählerstände fließen dann in eine gemeinsame Abrechnung ein.
Einfach gesagt: Die Marktlokation ist wichtig für die Abrechnung, die Messlokation fürs Ablesen.
Gerade bei PV-Anlagen, Wärmepumpen oder Mieterstromprojekten ist diese Unterscheidung wichtig.
Photovoltaikanlagen verändern die Stromflüsse: Sie speisen Strom ins Netz ein, decken Eigenverbrauch oder beides gleichzeitig. Auch Wärmepumpen oder Stromspeicher verändern das Lastprofil – die Marktlokation bildet diese Dynamik korrekt ab.
Damit klar ist, wie viel Strom wohin fließt, braucht jede Verbrauchs- oder Einspeisestelle eine eigene Marktlokation. Sie kann dabei sowohl den Strombezug aus dem Netz als auch die Einspeisung aus einer PV-Anlage abbilden. Auch bei Batteriespeichern oder steuerbaren Verbrauchern wie Wärmepumpen ist eine eindeutige Abbildung wichtig, um Verbrauch und Erzeugung korrekt zuzuordnen.
In komplexeren Setups – etwa bei Mehrfamilienhäusern mit Mieterstrom, Einliegerwohnungen oder kombinierten Einspeise- und Verbrauchsanlagen – ermöglicht die Marktlokation eine saubere Trennung und Berechnung. Dabei kann eine Marktlokation mehreren Messlokationen zugeordnet sein – oder umgekehrt.
Der örtliche Netzbetreiber legt fest, welche Marktlokationen es gibt, zum Beispiel bei einem neuen Netzanschluss, beim Umzug oder bei der Inbetriebnahme einer PV-Anlage. Jede Marktlokation bekommt eine eigene Kennung: die sogenannte „MaLo-ID“. Diese elfstellige Nummer steht auf der Strom- oder Gasrechnung und sorgt dafür, dass beim Anbieterwechsel oder bei Netzumbauten alles korrekt zugeordnet bleibt. Sie wird nach einem standardisierten Verfahren vergeben und bleibt über die gesamte Lebensdauer der Marktlokation bestehen.
Ein Beispiel: Eine Familie baut ein neues Haus mit einer PV-Anlage auf dem Dach und beantragt den Netzanschluss. Der Netzbetreiber vergibt für dieses Objekt eine neue Marktlokation. Diese ist fortan die eindeutige Bezugs- und Einspeisestelle für Strom – egal, wie viele Zähler (Messlokationen) installiert sind oder ob später ein Batteriespeicher oder eine Wärmepumpe hinzukommt. Die MaLo-ID sorgt dafür, dass der Energiefluss diesem Haushalt jederzeit eindeutig zugeordnet bleibt.