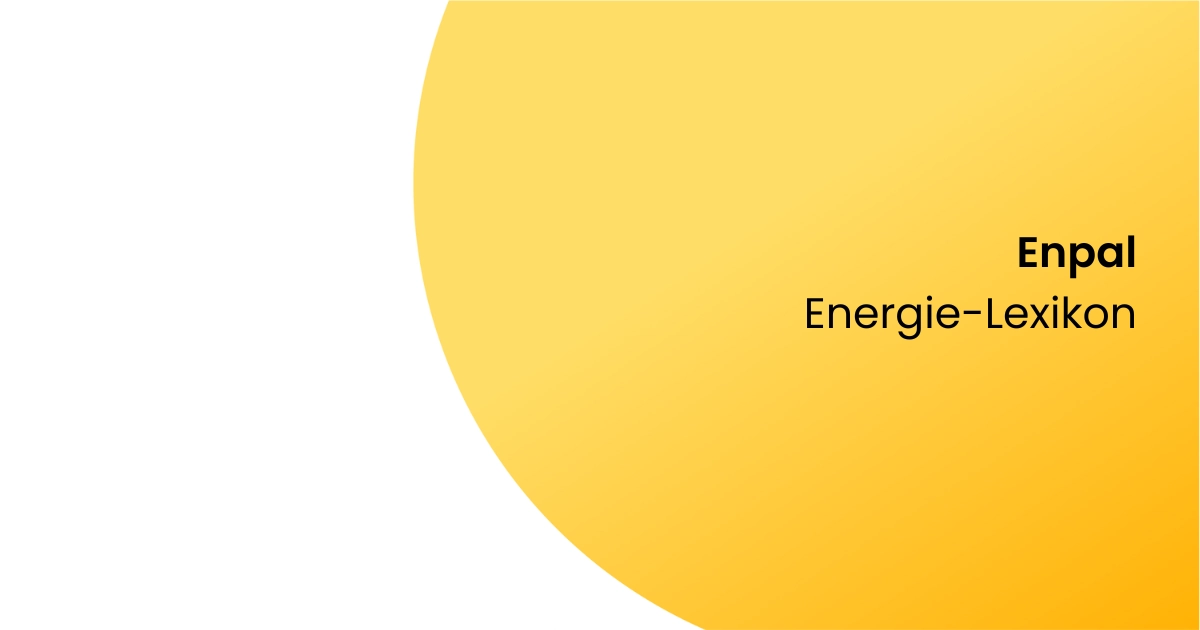
Eine Netzebene ist ein definierter Bereich innerhalb des Stromnetzes, in dem elektrische Energie auf einer bestimmten Spannungsebene transportiert oder verteilt wird. Jede Netzebene erfüllt eine spezifische Funktion – von der großräumigen Übertragung über weite Strecken bis hin zur Versorgung einzelner Haushalte. Die Einordnung erfolgt anhand der elektrischen Spannung in Volt.
Über sogenannte Umspannebenen wird die Spannung mithilfe von Transformatoren von einer Ebene zur nächsten angepasst. Die Netzebenen sind damit nicht nur für den technischen Betrieb relevant, sondern auch für die Berechnung von Netzentgelten und die Planung von Energieinfrastrukturen. So hängt zum Beispiel die Höhe der Netznutzungsentgelte auch davon ab, auf welcher Ebene Strom eingespeist oder entnommen wird.
Das Stromnetz in Deutschland ist in sieben sogenannte Netz- und Umspannebenen gegliedert. Diese Struktur beschreibt, auf welcher Ebene elektrische Energie erzeugt, transportiert, umgewandelt oder verbraucht wird. Die Einteilung umfasst sowohl die Spannungsebenen selbst als auch die Umspannbereiche zwischen ihnen:
Rechtlich und technisch definiert die Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) vier Spannungsebenen: Niederspannung (≤ 1 Kilovolt), Mittelspannung (> 1 kV und ≤ 72,5 kV), Hochspannung (> 72,5 kV und ≤ 125 kV) und Höchstspannung (> 125 kV). Diese Klassifikation – auch als Spannungsebenen bezeichnet – ist insbesondere für gesetzliche Regelungen und regulatorische Abrechnungen maßgeblich. Beide Modelle, die vier Spannungsebenen nach StromNEV und die sieben Netz- und Umspannebenen, ergänzen sich: Die eine definiert die technischen Spannungsbereiche, die andere strukturiert den Netzbetrieb im Detail.
Je nach Netzebene unterscheiden sich auch die typischen Verbrauchergruppen. Die Höchstspannung transportiert Strom über lange Distanzen und verbindet etwa Länder oder Bundesländer – hier speisen große Offshore-Windparks oder Pumpspeicherkraftwerke ein. Die Hochspannung versorgt große Industrieanlagen, Stadtwerke oder Umspannwerke, oft auch mit Strom aus Gaskraftwerken. Die Mittelspannung ist für die regionale Verteilung an Gewerbegebiete, Landwirtschaft oder kleinere Städte zuständig. Und die Niederspannung beliefert direkt Haushalte, Handwerksbetriebe oder Ladeinfrastruktur.
Photovoltaikanlagen auf Hausdächern speisen überschüssigen Strom direkt in das öffentliche Netz ein. Wärmepumpen nutzen diesen Strom wiederum für klimafreundliches Heizen. Beide Technologien sind typischerweise an das 230/400-Volt-Netz angeschlossen – also an die unterste Netzebene. Das Besondere dabei: Der Stromfluss verläuft nicht mehr nur „von oben nach unten“, sondern auch horizontal – etwa von einer PV-Anlage auf dem Nachbarhaus zur eigenen Wärmepumpe. Diese veränderte Flussrichtung erhöht die Komplexität im Netzmanagement und erfordert neue Ansätze zur Laststeuerung.
Weil das Stromnetz keine Energie speichern kann, muss zu jedem Zeitpunkt genau so viel Strom verbraucht werden, wie gleichzeitig eingespeist wird. Um dieses Gleichgewicht zu gewährleisten und die Netzfrequenz von exakt 50 Hertz zu halten, setzen Netzbetreiber ein mehrstufiges System ein – mit Momentanreserve, Primär-, Sekundär- und Tertiärregelung. Dass dieses System zuverlässig funktioniert, zeigen die Daten der Bundesnetzagentur: Im Jahr 2022 lag die durchschnittliche ungeplante Unterbrechungsdauer pro Letztverbraucher bei lediglich 12,2 Minuten pro Jahr – ein internationaler Spitzenwert.